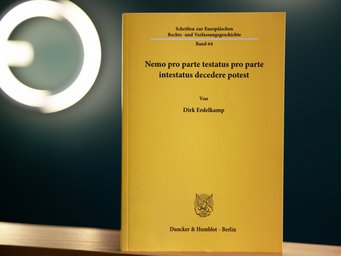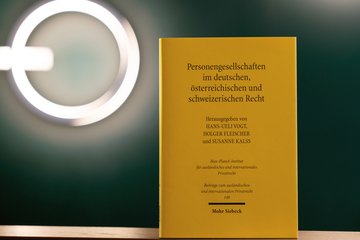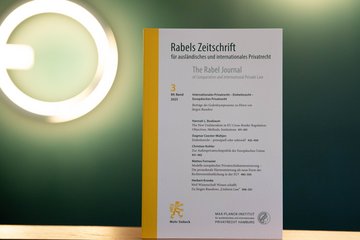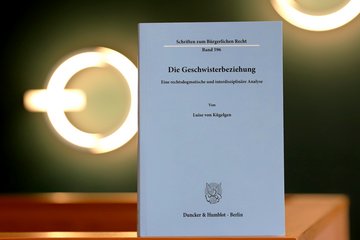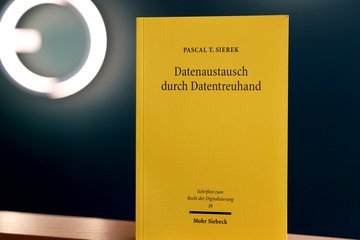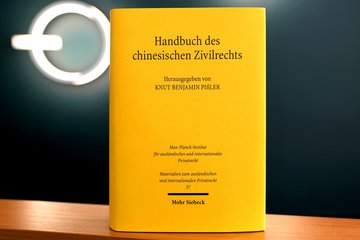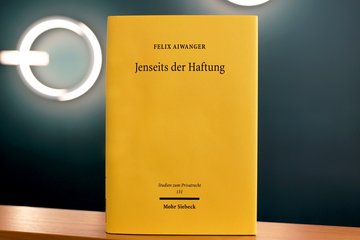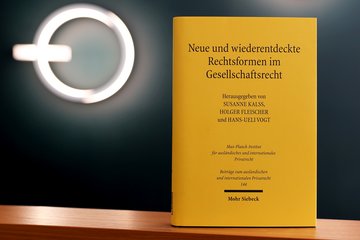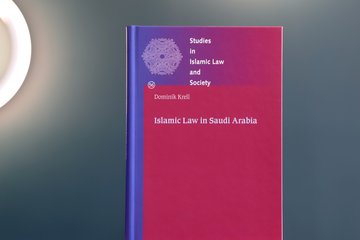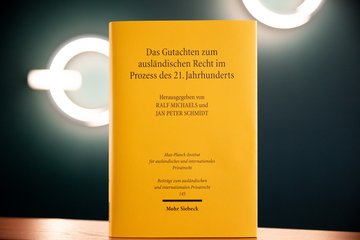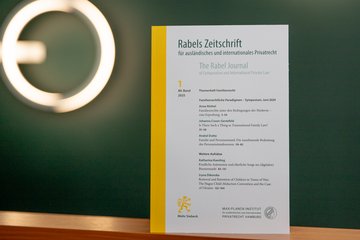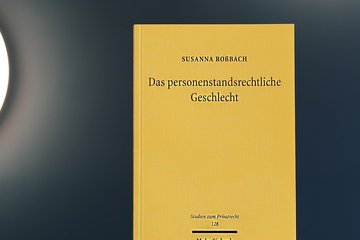Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest
Der Grundsatz, dass niemand sein Vermögen teils nach gewillkürter, teils nach gesetzlicher Erbfolge vererben könne, zählt zu den Eigenheiten des römischen Erbrechts, die in der Rechtswissenschaft späterer Epochen das größte Unverständnis hervorgerufen haben. In seiner Dissertation unternimmt Dirk Erdelkamp, ehemaliger wissenschaftlicher Assistent am Institut, eine Reise durch die Zeitgeschichte, indem er das Nemo-pro-parte-Prinzip und seine Rezeption von seinen Ursprüngen bis in die Gegenwart hinein verfolgt.
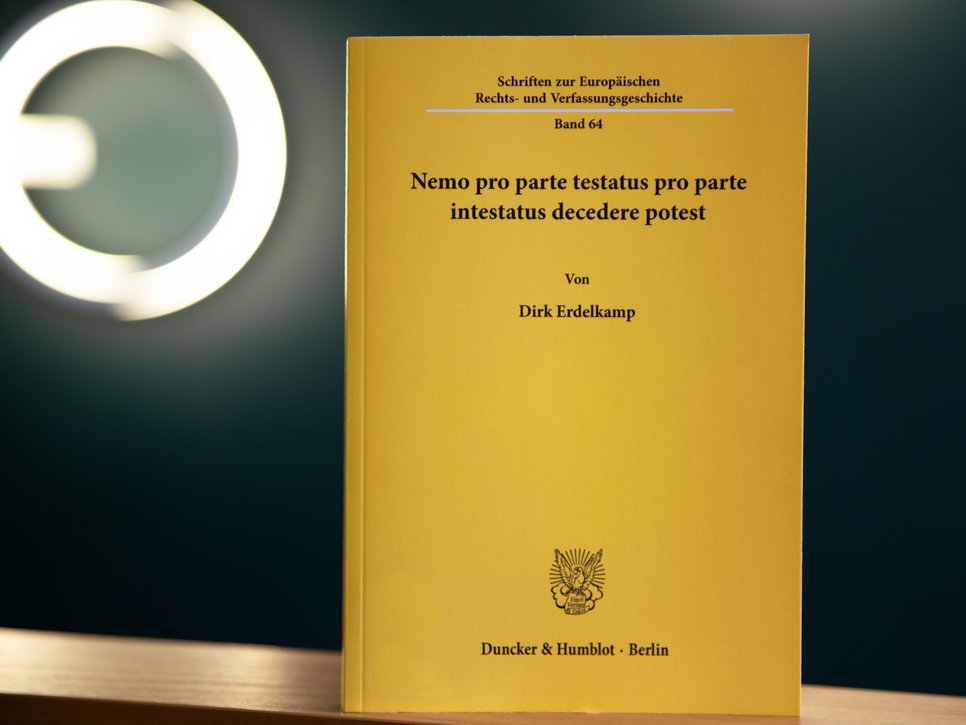
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Rezeptionsgeschichte des Nemo-pro-parte-Prinzips vom gemeinen Recht bis hin zu den neuzeitlichen Kodifikationen. Anschließend setzt Erdelkamp sich mit den zahlreichen Theorien auseinander, die im Laufe dieser Zeit zur Begründung des Prinzips entwickelt worden sind und stellt es dem heutigen deutschen Erbrecht gegenüber. Er beleuchtet die in Betracht kommenden Fallgruppen anhand der verfügbaren Rechtsprechung und kontrastiert die Ergebnisse mit einer Anwendung des Nemo-pro-parte-Prinzips. Dabei kann er zeigen, dass die Behauptung, das Prinzip führe zu unbilligen und mit dem Erblasserwillen in Widerspruch stehenden Ergebnissen, sich nicht ohne weiteres aufrechterhalten lässt. Er schließt mit der Feststellung, das Nemo-pro-parte-Prinzip habe bei all seiner Strenge jedenfalls die systematischen Unklarheiten und mitunter schwer vorhersehbaren Einzelfallentscheidungen vermieden, die das heutige deutsche Erbrecht in diesen Fällen prägen.
Dr. Dirk Erdelkamp studierte Rechtswissenschaft an der Bucerius Law School. Von 2019 bis 2023 war er wissenschaftlicher Assistent am Institut. 2023 wurde er von der Bucerius Law School promoviert.
Bildnachweis: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Bastian Kurzynsky