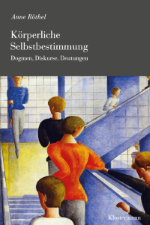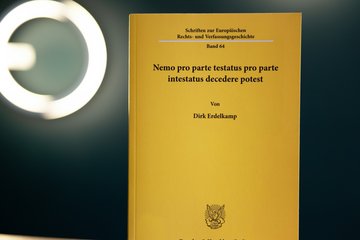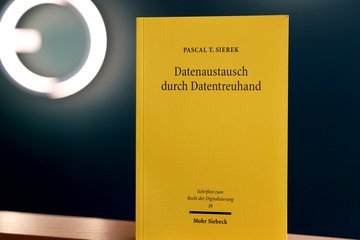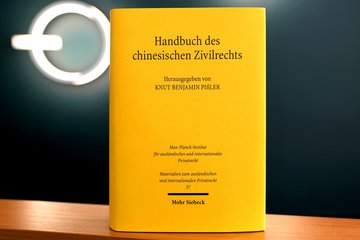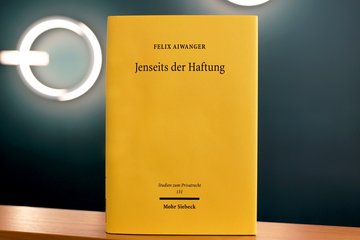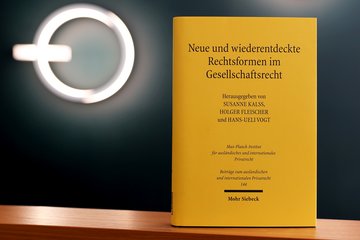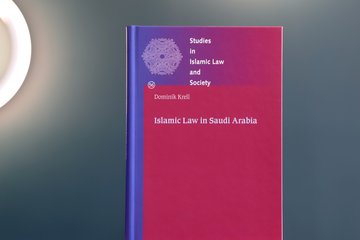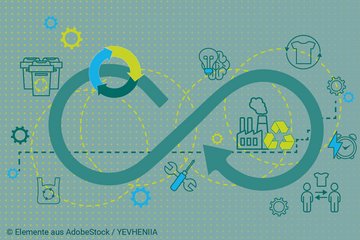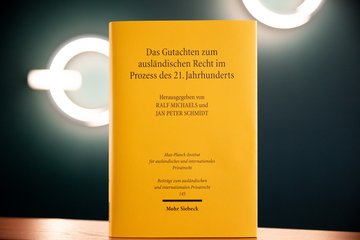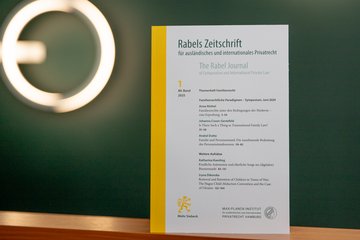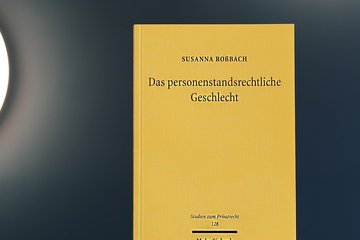Körperliche Selbstbestimmung – ein Recht mit Abstufungen
In ihrem neuen Buch beschreibt Institutsdirektorin Anne Röthel, wie körperliche Selbstbestimmung im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einem allgemeineren Recht geworden ist. Diese Entwicklung, so stellt sie fest, ist aber unvollendet geblieben. In ihrer Analyse nimmt sie drei Personengruppen in den Blick, für die körperliche Selbstbestimmung nach wie vor ein anderes Recht ist als für „normale“ Erwachsene: Patient*innen, Kinder und Betreute.
Körperliche Selbstbestimmung gilt als Menschenrecht. Das deutsche Grundgesetz verspricht und verteidigt den Schutz der körperlichen Unversehrtheit und Selbstbestimmung. Dennoch besteht darauf kein uneingeschränkter Rechtsanspruch. „Es gibt eine lange Tradition des Messens mit verschiedenem Maß“, sagt die Rechtswissenschaftlerin und nimmt diese überraschende Erkenntnis zum Anlass für eine Untersuchung darüber, wie sich Krankheit, Kindheit und Anderssein auf das rechtliche Verständnis körperlicher Selbstbestimmung auswirken. Sie geht der Entwicklung der Rechtsstellung von Patient*innen, Kindern und Betreuten in Deutschland seit der Wende zum 20. Jahrhundert nach. An zahlreichen Beispielen zeigt sie, wie sich ein Rest an Fremdbestimmung dieser Personengruppen durch Ärzt*innen, Eltern und Betreuer*innen bis in die Gegenwart fortsetzt, und legt ein Buch vor, das von Recht handelt, sich aber nicht nur an die Rechtswissenschaft wendet.
Ungleiches Schicksal und Rest an Unaufklärlichkeit
Röthel schreibt aus der Perspektive, dass körperliche Selbstbestimmung einen elementaren Wert bezeichnet und vom Recht so allgemein und weitreichend wie nur irgend möglich verwirklicht werden sollte. Ihre positive Bewertung von körperlicher Selbstbestimmung begründet sie mit zwei Argumenten.
Zum einen, so die Autorin, seien unsere Körper unser ungleiches Schicksal. In unterschiedliche Körper hineingeboren, haben wir Anteil an einem gemeinsamen, aber nicht gleichen Schicksal: „Kein Recht der Welt wird je Gebrechen, Veranlagungen, Unfälle, Krankheiten oder Infektionen verhindern können.“ Eine Art, die Ungleichheit dieses Schicksals zu lindern, bestehe in der Gewährleistung von körperlicher Selbstbestimmung.

„Wir haben es mit dem Ringen konkreter Koalitionen und Kräfteformationen zu tun, die zu bestimmten Zeitpunkten und aus benennbaren Motivationen in rechtliche Debatten und damit in den Entstehungszusammenhang des Rechts eingegriffen haben.”
– Institutsdirektorin Anne Röthel –
Zum anderen biete körperliche Selbstbestimmung den Ausweg aus Wissensproblemen. Röthel erläutert dies an einigen Kategorien, mit denen das Recht herkömmliche Abstufungen, Schattierungen und Gradierungen in Bezug auf körperliche Selbstbestimmung vornimmt: „Alter“, „Krankheit“ und „Behinderung“. Sie weist darauf hin, dass diese Kategorien zu einem für uns nicht sicher erkennbaren Ausmaß gesellschaftlich mitkonstruiert sind. Anschaulich beleuchtet sie auch die seit Simone de Beauvoirs Diktum „Man wird nicht als Frau geboren, man wird es“ schwelende Kontroverse in Bezug auf die Kategorie „Geschlecht“, die sich inzwischen auf die Kategorie „Rasse“ ausgeweitet hat: „Diese Debatten lassen sich nicht einfach abschließen, denn sie laufen auf Fragen zu, die unserer Erkenntnis nur begrenzt zugänglich sind.“ Denn: „Wie sollte sich mit letzter Gewissheit aufklären lassen, ob es einen vorgesellschaftlichen Ausgangspunkt gibt, wenn wir nicht ausschließen können, dass auch wir selbst und unser Denken immer schon »bis zum Hals« diskursiv geformt sind?“
Daran knüpft Röthel ein zentrales Motiv für ihre Untersuchung: „Ich bestehe auch deshalb auf körperlicher Selbstbestimmung, weil wir es in den meisten Fällen mit unlösbaren Begründungsproblemen zu tun bekommen, wenn es um die Bewertung körperlicher Entscheidungen geht. Jede rechtliche Abstufung von körperlicher Selbstbestimmung ist daher problematisch und jedes Mehr an körperlicher Selbstbestimmung erstrebenswert.“
Rechtsentwicklung in Nahaufnahmen
Röthel rekonstruiert und analysiert die Rechtsentwicklung auf den drei Feldern „Behandlung“, „elterliche Sorge“ und „Erwachsenenschutz“. Patient*innen, Kinder und Entmündigte, die seit 1992 Betreute heißen, galten lange Zeit als besonders. Das heißt, Handlungen, die ansonsten als unzulässige Gewalt, rechtswidriger Zwang und strafbare Verletzung galten, wurden ihnen gegenüber als Heilung, Erziehung und Fürsorge ausgewiesen.
In drei groß angelegten Nahaufnahmen richtet die Autorin den Blick unter anderem auf Akteure, Auslöser und Argumente, die sie für jedes Feld einer eingehenden Prüfung unterzieht: War die Verallgemeinerung körperlicher Selbstbestimmung mehr ein Werk der Rechtsprechung oder von sozialen Bewegungen und politischer Gesetzgebung? Welche Rolle spielte die Rechtswissenschaft, welche das Grundgesetz? Wie wurden Abstufungen von körperlicher Selbstbestimmung begründet? Wann beziehungsweise warum funktionieren manche Argumente nicht mehr?
Röthel findet in ihren Studien zwar viele Belege, die die Erzählung von der Aufstiegsbewegung der Moderne in Richtung „mehr Selbstbestimmung“ bestätigen. Gleichzeitig stellt sie fest, dass hier keine untergründige Mechanik am Werk war und auch kein ursprünglicher Wesenszug menschlichen Strebens: „Wir haben es mit dem Ringen konkreter Koalitionen und Kräfteformationen zu tun, die zu bestimmten Zeitpunkten und aus benennbaren Motivationen in rechtliche Debatten und damit in den Entstehungszusammenhang des Rechts eingegriffen haben.“
Gegendiskurse mit wiederkehrendem Muster
Es waren unterschiedliche Weichenstellungen, die in den drei untersuchten Feldern am Beginn der Rechtsentwicklung standen. Die Ausrichtung war indes durchweg dieselbe, nämlich hin zu mehr körperlicher Selbstbestimmung. Auch bei den Hindernissen, die zu überwinden waren, damit körperliche Selbstbestimmung allmählich zu einem Recht auch von Patient*innen, Kindern und Betreuten werden konnte, erkennt Röthel ein wiederkehrendes Muster. Die Einwände und Begründungen, mit denen Abstufungen der körperlichen Selbstbestimmung jeweils plausibel gemacht wurden, subsumiert und analysiert sie unter dem Begriff „Gegendiskurse“.
„Das einmal Erreichte könnte selbstverständlich
werden, bis es nicht mehr als Errungenschaft spürbar ist.
Dies könnte dazu führen, Gegenläufiges zu überblenden.“
– Institutsdirektorin Anne Röthel –
Dabei geht es um eine Verbesonderung, die auf drei Ebenen hergeleitet wird: auf der Ebene des Handlungssinns, der Ebene der Betroffenen und der Ebene der Ermächtigten. Der erste Begründungsstrang lautet, dass es im Verhältnis von Ärzt*innen und Patient*innen, Eltern und Kindern sowie Vormündern und Entmündigten beziehungsweise Betreuer*innen und Betreuten um Handlungen mit besonderem Sinn geht. Nämlich um Heilung, Erziehung und Fürsorge. Der zweite Begründungsstrang zielt auf Eigentümlichkeiten der Betroffenen: weil Patient*innen „krank“, Kinder „unvernünftig“ oder „unreif“ und weil Entmündigte „wahnsinnig“ oder Betreute „geisteskrank“ sind. Der dritte Begründungsstrang zielt auf Eigentümlichkeiten der so Ermächtigten, also Besonderheiten in deren Stellung, Amt, Stand, Ethos, Kompetenz oder Erfahrung.
Dogmen und Deutungen
Röthel beschreibt drei aufeinanderfolgende Phasen der Entwicklung rechtlicher Dogmen zur körperlichen Selbstbestimmung von Patient*innen, Kindern und Entmündigten beziehungsweise Betreuten seit Beginn des 20. Jahrhunderts: patriarchal, paternalistisch und partizipativ. Sie münden in eine Gegenwart, in der das subjektive Wohl und der Wille der Betroffenen in den Vordergrund getreten sind, verbunden mit subjektivierten Entscheidungsmaßstäben sowie Anhörungs- und Aufklärungspflichten. Denkt man diesen Verlauf weiter, so die Autorin, würde der nächste Schritt darin liegen, die Verbesonderung von Patient*innen, Kindern und Betreuten aufzuheben. Eine solche Dogmenphase wäre als postkategorial zu beschreiben.
Abschließend zeigt sie, wie postkategoriale Konzepte von körperlicher Selbstbestimmung sich sowohl als Zielpunkt als auch als Kipppunkt deuten lassen: „Kindsein und Schizophrenie, Suchtverhalten und demenzielle Symptome tragen eine reale Ungleichheitsdimension in sich. Diese lässt sich nicht dadurch beseitigen, dass Kinder und Betreute aus dem Recht als Bezugspunkt verschwinden oder zu vulnerablen Personen umetikettiert werden.“ Wenn körperliche Selbstbestimmung in keiner Hinsicht mehr an rechtliche Kategorien geknüpft wäre, könnte dies, so warnt Röthel, Forderungen nach einem weitergehenden Rückzug des Rechts nähren. „Das einmal Erreichte könnte selbstverständlich werden, bis es nicht mehr als Errungenschaft spürbar ist. Dies könnte dazu führen, Gegenläufiges zu überblenden.“

Headergrafik: Johanna Detering mit Illustrationen aus © Adobe Stock, AJay
Porträt Anne Röthel: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Patrice Lange