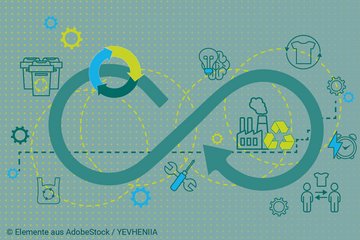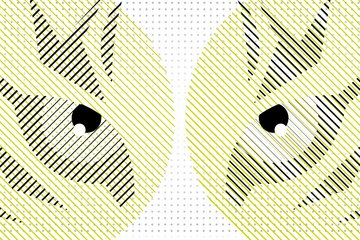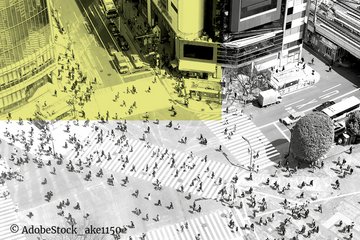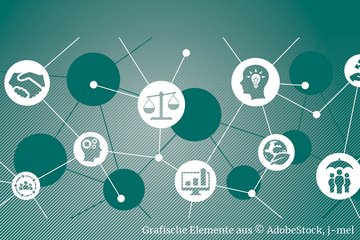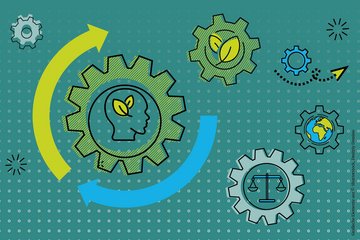Plädoyer für eine Reform des deutschen Erbrechts
Was geschieht mit unserem Vermögen nach unserem Tod? Diese Frage wird irgendwann die meisten Menschen beschäftigen – sei es, dass sie sich zu überlegen haben, wer ihr Vermögen eines Tages erhalten soll, sei es, dass sie selbst aus einem Erbfall begünstigt werden. Was das deutsche Erbrecht im Einzelnen vorschreibt und welche Probleme es birgt, ist nur wenigen klar. Bemerkenswert ist, dass es seit seinem Inkrafttreten als Fünftes Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahre 1900 in nur relativ geringfügig geänderter Form gilt, während die meisten Nachbarländer Deutschlands diese Materie in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten grundlegenden Reformen unterzogen haben. „Eine Generalreform des deutschen Erbrechts ist überfällig“, sagt Reinhard Zimmermann, Direktor emeritus am Institut, und hat diese Empfehlung in einem Vortrag vor der Zivilrechtslehrervereinigung ausführlich begründet. Wie lauten seine Empfehlungen an den Gesetzgeber?
Sie erforschen seit vielen Jahren erbrechtliche Fragen in historischer und vergleichender Perspektive. Was sind die Grundstrukturen des Erbrechts?
Ausgangspunkt ist in Deutschland wie in den anderen Ländern unseres Kulturkreises der Grundsatz der Testierfreiheit als erbrechtliche Ausprägung der Privatautonomie. Jeder Erbrechtsgesetzgeber steht damit vor folgenden Grundfragen: Wie kann gewährleistet werden, dass der Erblasser eine freie Entscheidung über die Verteilung seines Vermögens trifft und dass diese Verfügung tatsächlich von ihm herrührt? Wo liegen die Grenzen der Testierfreiheit? Insbesondere: Bedarf es eines Schutzes der nächsten Angehörigen vor Enterbung und wie ist dieser Schutz gegebenenfalls auszugestalten? Wie ist die Erbfolge zu organisieren, wenn der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen hinterlassen hat? Und: Wie ist die Abwicklung des Nachlasses zu regeln, also die Verteilung des Vermögens an die letztwillig oder gesetzlich Begünstigten und an die Gläubiger des Verstorbenen?
Wie muss man sich den Prozess der Entstehung des deutschen Erbrechts vorstellen?
Der Gesetzgeber hatte den Auftrag, das bürgerliche Recht in einer zeitgemäßen Form kodifizierend zusammenzufassen. Es galten in Deutschland ja eine Vielzahl verschiedener Rechtsordnungen, vom französischen Code civil über das Preußische Allgemeine Landrecht oder das Sächsische BGB bis hin zum römischen Recht der Antike in zeitgenössischer Auslegung. Soweit wie möglich war also auf die diesen Rechten zugrundeliegende gemeinsame Tradition zurückzugreifen. Vielfach bestanden aber auch erhebliche Unterschiede. Hier waren Entscheidungen zu treffen, und das ist dem Gesetzgeber unterschiedlich gut gelungen. Teilweise wurden Regelungsmuster umgesetzt, die für das Gebiet des Deutschen Kaiserreichs neu waren, und hier ist zu fragen, wie sie sich seither bewährt haben.

„Eine Generalreform des deutschen Erbrechts ist überfällig.“
– Reinhard Zimmermann –
Können Sie einige Grundentscheidungen nennen und ob sie sich bewährt haben?
Zu all den eingangs genannten Fragen hat sich die Regelung des BGB als problematisch erwiesen.
(i) Die damals außerordentlich umstrittene Einführung des eigenhändigen Testaments war im Prinzip richtig, doch waren die Anforderungen zunächst deutlich zu strikt. Zudem erscheint das Erfordernis der Eigenhändigkeit im Zeitalter digitaler Kommunikation in ganz anderem Licht als im Jahre 1900.
(ii) Die demographische Entwicklung lässt es als zunehmend dringend erscheinen, darüber nachzudenken, wie selbstbestimmtes Testieren alter und hilfsbedürftiger Menschen gewährleistet werden kann.
(iii) Die Begrenzung der Testierfreiheit im Wege eines „Pflichtteilsrechts“ der nächsten Angehörigen des Erblassers hat sich als hochproblematisch erwiesen; sie beschränkt die Testierfreiheit in ganz erheblichem Ausmaß, ohne dass dafür ein Bedürfnis bestünde.
(iv) Was die gesetzliche Erbfolge betrifft, die dann eingreift, wenn keine Verfügung von Todes wegen vorliegt, so übernahm der BGB-Gesetzgeber die sogenannte „Parentelordnung“, die dem naturrechtlichen Denken der frühen Neuzeit entstammt und in Österreich bereits seit fast einem Jahrhundert gegolten hatte. Diese Entscheidung hat sich im Prinzip bewährt, setzt sie doch den Gedanken einer Familienerbfolge in besonders überzeugender Weise um. Nicht bewährt hat sich hingegen die Idee einer unbegrenzten Familienerbfolge, die dazu führt, dass auch mit dem Erblasser sehr weit entfernt verwandte Menschen zu Erben berufen sein können – Menschen, zu denen keinerlei Kontakt bestand oder besteht. Das deutsche BGB entschied insoweit gegen den rechtsvergleichend erkennbaren Entwicklungstrend und steht heute fast vollkommen isoliert da.
(v) Und schließlich sind die Regeln über die Nachlassabwicklung überaus kompliziert und enthalten eine Reihe von Fallstricken; auch in diesem Punkt verfolgt das deutsche Recht ein System, mit dem es international allein steht.
Wie zeigen sich die erwähnten Defizite?
Darin, dass einerseits immer wieder letztwillige Verfügungen unwirksam sind, an deren Authentizität niemand zweifelt; dass andererseits aber auch Verfügungen anerkannt werden, die vom Erblasser in einer Situation besonderer Vulnerabilität errichtet worden sind. Zu den Einzelheiten des Pflichtteilsrechts (etwa der Berechnung des Pflichtteils) und zu Möglichkeiten seiner Umgehung sind Handbücher von mehr als tausend Seiten geschrieben worden. Zudem ist der Pflichtteil ein erheblicher Störfaktor bei der Unternehmensnachfolge. Die unbegrenzte Familienerbfolge hat das Entstehen einer Industrie von „Erbensuchern“ zur Folge gehabt. Und ein Hauptdefizit der Nachlassabwicklung liegt darin, dass das BGB dem Erben in der Regel nicht ermöglicht, die Erbschaft anzunehmen und selbst abzuwickeln, ohne das Risiko einer Haftung für Erblasserschulden mit dem eigenen Vermögen zu laufen. Das Mittel der Wahl zur Vermeidung von Haftungsrisiken ist deshalb gegenwärtig die Flucht in die Erbausschlagung. Dass das ein unbefriedigender Zustand ist, liegt auf der Hand.
Welche Handlungsoptionen hat der Gesetzgeber?
Hier ist ein Blick in ausländische Rechtsordnungen hilfreich. Der deutsche Gesetzgeber hätte darüber nachzudenken, die Formvorschriften für Testamente zu ajourieren (oder auch eine „harmless error rule“ einzuführen, wie sie in einer Reihe von Rechtsordnungen in der Tradition des common law gilt). Er könnte einen neuen Tatbestand der Anfechtung von Testamenten wegen „undue influence“ schaffen. Er sollte in Sachen Familienerbfolge eine Grenze nach den ersten zwei Ordnungen (also: Abkömmlinge sowie Eltern und deren Abkömmlinge, plus möglicherweise Großeltern) ziehen und danach den Nachlass an den Staat fallen lassen.
„Ein Hauptdefizit der Nachlassabwicklung liegt darin, dass das BGB
dem Erben in der Regel nicht ermöglicht, die Erbschaft
anzunehmen und selbst abzuwickeln, ohne das Risiko einer Haftung für
Erblasserschulden mit dem eigenen Vermögen zu laufen.“
– Reinhard Zimmermann –
Das Pflichtteilsrecht hätte der Gesetzgeber durch ein am Bedarf orientiertes Unterhaltsmodell zu ersetzen (und dadurch die Testierfreiheit zu stärken). Und im Hinblick auf die Nachlassabwicklung wäre eine Systemumstellung im Sinne einer prinzipiellen, kraft Gesetzes eintretenden Beschränkung der Haftung des Erben zu empfehlen. Damit würde zugleich der schwer erklärbare Unterschied zur Rechtslage bei der Erbenmehrheit beseitigt. Vorbilder für eine derartige Regelung gibt es nicht nur in ausländischen Rechten, sondern auch in der Geschichte des deutschen Rechts.
Welche Defizite sehen Sie noch?
Es gibt eine Reihe weiterer Desiderate, die schon seit Längerem vorgebracht worden sind, etwa im Juristentagsgutachten von Anne Röthel von 2010. Es geht z.B. um eine weitere Stärkung des gesetzlichen Erbrechts des überlebenden Ehegatten, da dieser normalerweise stärker auf den erbrechtlichen Erwerb angewiesen ist als die Kinder des Erblassers. Ferner wird der Zugewinnausgleich im Todesfall bislang dadurch verwirklicht, dass der gesetzliche Erbteil pauschal um ein Viertel erhöht wird. Das ist eine ausgesprochen unglückliche Lösung. Zu fordern wäre also eine Entflechtung von Güterrecht und Erbrecht.
Ein dritter Punkt betrifft die Ausgleichung wirtschaftlich bedeutsamer Vorempfänge im Verhältnis der Abkömmlinge des Erblassers untereinander. Sie findet nach BGB nur in Ausnahmefällen statt, insbesondere bei Ausstattungen. Von zentraler Bedeutung ist damit hier ein Begriff, der eng mit der Wirtschafts-, Familien- und Sozialordnung vergangener Zeiten zusammenhängt. Hier weisen mutmaßlicher Erblasserwille, normativer Gleichbehandlungsanspruch und der Gedanke einer vorweggenommenen Erbfolge allesamt in dieselbe Richtung, nämlich einer deutlichen Erweiterung der Ausgleichungspflicht. Problematisch sind auch etwa die Vorschriften über das gemeinschaftliche Testament, weil sie nur ungenügenden Schutz gegenüber unbedachter und ungewollter Bindung bieten. Weitere Punkte ließen sich nennen; es bedürfte im Grunde eines historisch-kritischen Durchganges durch das gesamte Fünfte Buch des BGB unter Berücksichtigung auch der rechtsvergleichenden Perspektive.
Zu berücksichtigen ist schließlich auch die Frage, ob und inwieweit der Gesetzgeber einen Erbfall zum Anlass nehmen sollte, eine gesamtgesellschaftlich wohltätige Vermögensabschöpfung vorzunehmen. Hier lässt aufhorchen, dass führende deutsche Steuerrechtler seit Längerem das geltende System der Erbschaftsteuer als „Musterbeispiel politisch-ökonomischer Fehlsteuerung“ betrachten.
Reinhard Zimmermann, Grundentscheidungen im Recht der Erbfolge des BGB: Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Rechtspolitik, Archiv für die civilistische Praxis 225 (2025) (im Erscheinen)
Headergrafik: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering
Porträt Reinhard Zimmermann: © David Ausserhofer