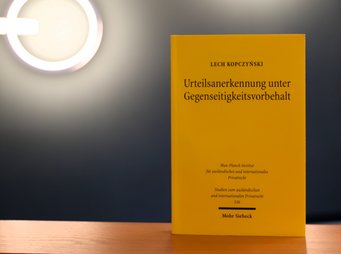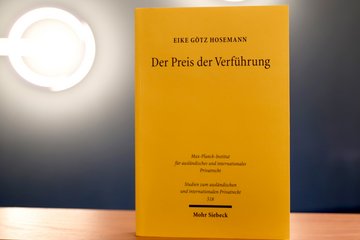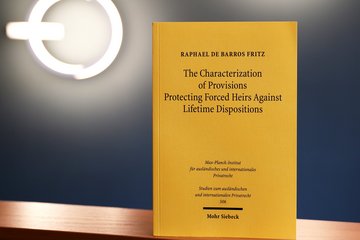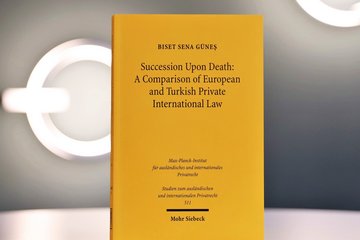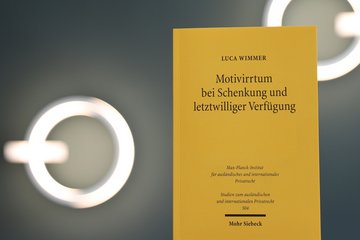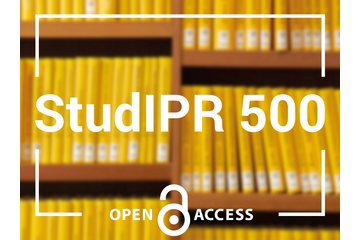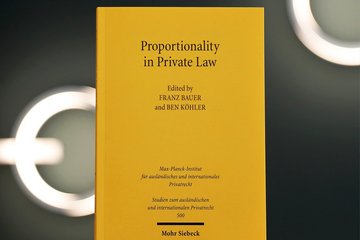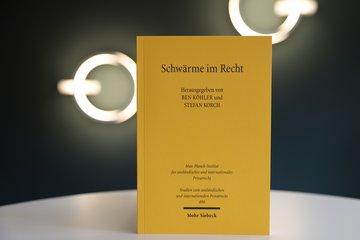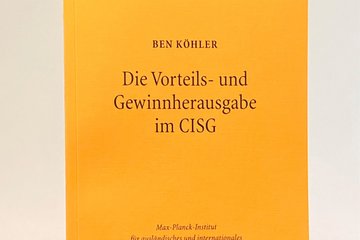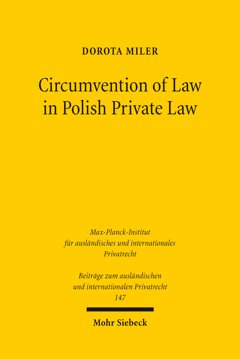Urteilsanerkennung unter Gegenseitigkeitsvorbehalt
Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen steht bisweilen unter dem Vorbehalt, dass der Urteilsstaat im umgekehrten Fall ebenso verfährt. Damit wird die Durchsetzung privater Rechte von staatlichem Verhalten abhängig gemacht. Lech Kopczyński, ehemaliger wissenschaftlicher Assistent am Institut, analysiert in seiner kürzlich erschienenen Dissertation die Frage, ob solche Gegenseitigkeitserfordernisse mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) vereinbar sind.
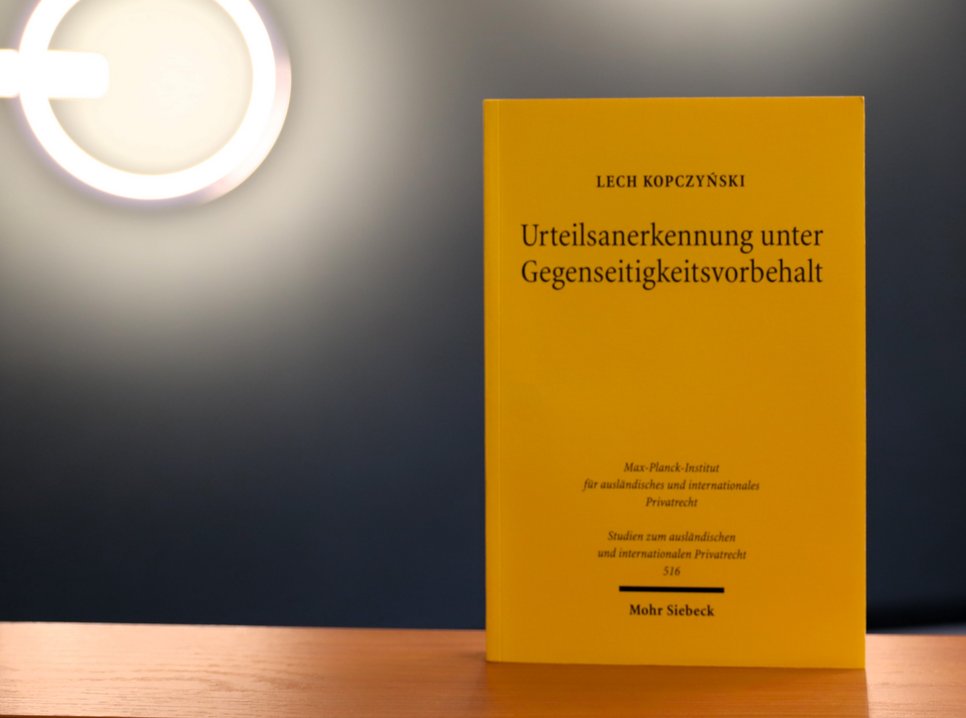
Grundsätzlich steht es Staaten frei, ausländische Urteile anzuerkennen oder ihnen die Anerkennung zu verweigern. Das ist Ausfluss ihrer Staatssouveränität. Trotzdem werden Gegenseitigkeitserfordernisse seit langem kritisiert, weil sie die grenzüberschreitende Durchsetzung von Zivilentscheidungen von einer Bedingung abhängig machen, auf die die Prozessparteien keinen Einfluss haben: Dem Wohlverhalten des Urteilsstaats. Dadurch verkörpern sie ein Primat staatlicher Interessen im internationalen Zivilprozessrecht, das antiquiert anmutet und zunehmend rechtfertigungsbedürftig erscheint.
Gegenseitigkeitserfordernisse stehen in einem Spannungsverhältnis zum stetig wachsenden Einfluss grund- und menschenrechtlicher Wertungen bei der grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung. Der Autor nimmt die jüngere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Anlass für seine Untersuchung. Dabei geht er der Frage nach, ob Gegenseitigkeitserfordernisse mit der EMRK vereinbar sind oder ob sie eine unverhältnismäßige Verkürzung des Rechts auf effektive Rechtsdurchsetzung darstellen. Zuvor zeigt Lech Kopczyński die historischen Wurzeln von Reziprozitätsvorbehalten auf, beleuchtet das Gegenseitigkeitsprinzip im common law und nimmt eine rechtsvergleichende Bestandsaufnahme verschiedener europäischer Rechtsordnungen vor.
Dr. Lech Kopczyński, M.Jur. (Oxford), studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, St. Petersburg, Bonn, Münster und Oxford. Von 2016 bis 2020 war er Mitarbeiter am Institut. 2022 wurde er von der Universität Hamburg promoviert. Seine Dissertation wurde von Jürgen Basedow betreut. Seit 2020 ist er als Rechtsanwalt tätig.
Bildnachweis: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht