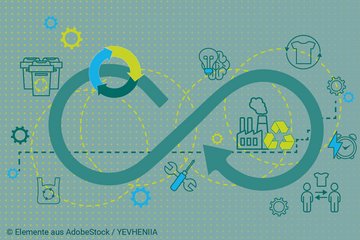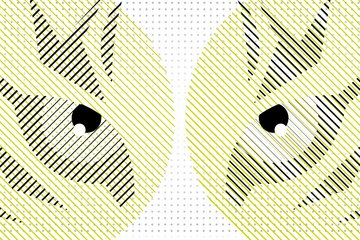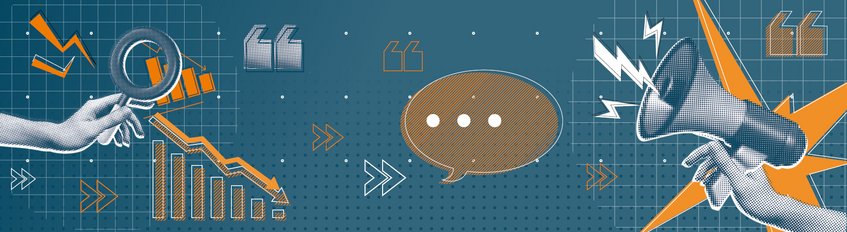
Von der Empörung zur Regulierung
Unternehmensskandale und ihre juristische Aufarbeitung
Betrügereien, Pleiten, Börsenkrach – der Stoff, aus dem Unternehmensskandale gemacht sind, lässt zunächst nicht an Fortschritt denken. Dennoch haben Bilanz-, Finanz- und Wirtschaftsskandale über Epochen hinweg die Entwicklung des Aktien- und Kapitalmarktrechts maßgeblich mitgeprägt. Dieses Rechtsgebiet, so heißt es häufig, sei eine Geschichte seiner Reformen. Tatsächlich sind viele von ihnen aus dem Handlungsdruck von Skandalen hervorgegangen. Eine von Institutsdirektor Holger Fleischer ins Leben gerufene Forschungsreihe widmet sich der rechtlichen Aufarbeitung von Unternehmensskandalen rund um den Globus.
Jüngstes Beispiel in Deutschland ist das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) von 2021. Ihm vorausgegangen war der Zusammenbruch des Wirecard-Konzerns. Schon seit 2015 hatte die Financial Times kritische Artikel über das bayerische Fintech-Unternehmen veröffentlicht. Am 18. Juni 2020 musste der Zahlungsdienstleister öffentlich bekennen, dass 1,9 Milliarden Euro in seinen Büchern fehlten. So entfaltete sich der bisher größte Bilanzskandal der Bundesrepublik. Etwa 50.000 Aktionäre erlitten Verluste und meldeten Schadensersatzforderungen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro an. Diverse Strafverfahren gegen ehemalige Vorstände sind ebenso wenig abgeschlossen wie das im August 2020 eröffnete Insolvenzverfahren. Ein im Oktober 2020 eingesetzter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, weshalb die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Bilanzbetrug nicht früher entdeckt hat. Deren Befugnisse bei der Finanzkontrolle wurden im FISG schließlich stark ausgeweitet.
„Skandalgetriebene Reformgesetzgebung ist ein verbreitetes Phänomen, das bisher wissenschaftlich unterbelichtet ist“, sagt Fleischer. „Unternehmensskandale sind wesentliche Treiber gesetzgeberischer Reformprozesse. Was fehlt, ist eine systematische Erschließung und Auswertung dieser Zusammenhänge über Zeit- und Ländergrenzen hinweg.“ Während die großen Wirtschaftsskandale aus Vergangenheit und Gegenwart schon oft zum Thema populärwissenschaftlicher Abhandlungen geworden sind, hat sich die Wissenschaft lange in Zurückhaltung geübt. Erst in letzter Zeit haben verschiedene Disziplinen, wie etwa die Wirtschaftsgeschichte, die Rechnungslegung oder die Management- und Finanzierungsforschung sie zum Gegenstand tieferer Analysen gemacht.
Dynamische Prozesse
Die neue Forschungsreihe am Hamburger Institut widmet sich den unternehmensrechtlichen Auswirkungen von Bilanz-, Finanz- und Wirtschaftsskandalen. Gemeinsam mit seinem Team hat der Rechtswissenschaftler und Ökonom Fleischer es sich zur Aufgabe gemacht, juristische Regulierung als Folge von Unternehmensskandalen systematisch-vergleichend aufzuarbeiten. Den theoretischen Rahmen hierfür bieten Erkenntnisse aus der interdisziplinär ausgerichteten Skandalforschung.
„Skandale sind keine statischen Ereignisse, sondern dynamische Prozesse“, betont Fleischer. Häufig bestimmen vier aufeinanderfolgende Phasen den Skandalverlauf: Es beginnt mit dem skandalkonstituierenden Normbruch, bei dem es sich nicht unbedingt um einen Gesetzesverstoß handeln muss. Ihm folgt die Enthüllung, die den Normbruch in das öffentliche Scheinwerferlicht stellt. Anschließend setzt, befeuert von den Medien, Empörung ein.

„Skandalgetriebene Reformgesetzgebung ist ein
verbreitetes Phänomen, das bisher wissenschaftlich
unterbelichtet ist.“
– Institutsdirektor Holger Fleischer –
Narrative über Missstände und Schuldzuweisungen entfalten ihre Wirkung. So setzt nach Bekanntwerden eines Skandals häufig eine „Schlacht der Narrative“ ein. Um dies abzubilden, greifen Fleischer und sein Team auf die sogenannte Sequenzanalyse von Tageszeitschriften zurück, prüfen also, wie verschiedene Medien am ersten, zweiten, fünften, zehnten Tag usw. nach Bekanntwerden eines Skandals berichtet haben. „Das Ob und Wie einer gesetzgeberischen Intervention hängt maßgeblich von der Wahrnehmung des Skandals in der Öffentlichkeit ab“, sagt Fleischer. In der Konsequenz kann es zu zivil- oder strafrechtlichen Verurteilungen sowie vor allem auch zur Ausarbeitung von Reformgesetzen kommen.
Bereichernder Kontext
„Skandalforschung lebt davon, die größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhänge einzubeziehen“, sagt Fleischer. „Jeder einzelne Unternehmensskandal für sich bietet ein lohnendes Studienobjekt. In dieser Hinsicht können die Rechtsfakultäten viel von den Business Schools lernen, die bereits seit über hundert Jahren Case Studies erfolgreich als Wissensressource nutzen.“ Das Forschungsteam um Fleischer beleuchtet jeden untersuchten Fall in seinem ökonomischen, politischen und sozialen Kontext. Näher in den Blick genommen werden auch die für den Skandal verantwortlichen Personen und ihre Motive. Wichtige Leitfragen drehen sich außerdem darum, wie die skandalisierten Handlungen ans Licht kommen und wer die Geschädigten sind. Von großem Interesse schließlich sind die Bedingungen, von denen es abhängt, ob ein Skandal in Reformgesetzgebung mündet.
Historische Tiefe
Skandalgetriebene Reformgesetze sind kein neues Phänomen. Genau 300 Jahre vor dem Untergang von Wirecard ereignete sich in London ein Finanzskandal, der, so Fleischer, zu den Schlüsselereignissen der internationalen Gesellschaftsrechtsentwicklung zählt. Die zur Refinanzierung von Staatsschulden eingesetzte Aktiengesellschaft South Sea Company verursachte mit leeren Versprechungen über die Erfolgsaussichten des Südseehandels eine Spekulationsblase, deren Platzen im September 1720 einen Börsenkrach auslöste. Wenige Monate zuvor hatte das Parlament mit dem Bubble Act ein Reformgesetz verabschiedet, das die Gründung neuer Joint Stock Companies untersagte, wodurch der Kollaps der South Sea Company jedoch nicht mehr abgewendet werden konnte. Diese hatte durch die Regulierung sogar eine Aufwertung erfahren, die ihren Höhenflug weiter anheizte und den Schaden am Ende vergrößerte. Der in die Wirtschaftsgeschichte eingegangene Bubble Act war also eine, wenn auch gescheiterte, vorbeugende Maßnahme und keine Reaktion auf den Zusammenbruch der Londoner Börse. Gleichwohl ist er eingebettet in einen Kontext skandalöser Machenschaften aus Bestechung und Betrug sowie dem Ruin vieler Investoren.
„Unternehmensskandale sind kollektive Lernerfahrungen. Ihre
systematisch-vergleichende Erforschung steht noch am Anfang.
Für ihre Analyse lassen sich eine Reihe theoretischer
Perspektiven fruchtbar machen.“
– Institutsdirektor Holger Fleischer –
Die Chronologie skandalinduzierter Reformgesetze führt hierzulande zurück in das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert. Vier Großskandale haben im Kaiserreich und in der Weimarer Republik das Gesicht des deutschen Aktien-, Bank-, Bilanz- und Börsenrechts maßgeblich verändert. Gescheiterte Eisenbahnfinanzierungen, stecken gebliebene Immobilienprojekte und Schwindelgründungen führten zur Aktienrechtsnovelle von 1884, der Geburtsstunde des modernen Aktienrechts in Deutschland. Unterschlagungen von Berliner Privatbankiers gaben Anlass zur Einführung des Depotgesetzes und des Börsengesetzes von 1896. Der betrügerische Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen Versicherung zog mit der Reform des Versicherungsaufsichtsgesetzes von 1931 die Einführung der jährlichen Abschlussprüfungen für große Versicherungsunternehmen nach sich. Der Doppelkollaps von Europas größtem Wollkonzern Nordwolle und seiner Hausbank Danatbank, damals Deutschlands zweitgrößte Privatbank, bewirkte 1931 den Erlass einer Notverordnung, mit der der Rückerwerb eigener Aktien neu geordnet und die unabhängige Abschlussprüfung auf alle Aktiengesellschaften erstreckt wurde. Zudem wurden erstmals zentrale Instanzen zur Beaufsichtigung des Kreditwesens eingeführt.
In die Zeit der Bonner Republik fällt unter anderem der Zusammenbruch der Kölner Herstatt-Bank und in dessen Gefolge die Zweite Novelle des Kreditwesengesetzes von 1976. Die Affären rund um den Bielefelder Sportbodenhersteller Balsam, die Bremer Vulkan-Werft, den Baukonzern Philipp Holzmann und die Frankfurter Metallgesellschaft gaben in der Berliner Republik Anlass zum Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) von 1998. Das rasante Wachstum des Neuen Marktes und die Dotcom-Blase zogen eine Reihe von Skandalen nach sich, die der Gesetzgeber mit dem Vierten Finanzmarktförderungsgesetz von 2002 beantwortete. Die Siemens-Korruptionsaffäre von 2006 läutete in der Bundesrepublik das Compliance-Zeitalter ein. 2015 löste die Dieselaffäre bei Volkswagen eine nationale und internationale Prozesslawine aus. Sie beförderte die Verabschiedung der EU-Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher sowie die Einführung des Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof.
Erfolge, Lernerfahrungen, Perspektiven
Während die historische Auswertung von Unternehmensskandalen der Erkundung von Modernisierungsprozessen dient, stellt sich bei jeder Fallanalyse auch die Frage, ob sich die daraus hervorgegangene Regulierung im Nachhinein als effektiv erwiesen hat. Zu den unbestrittenen Erfolgen skandalgetriebener Gesetzgebung gehört beispielsweise die mit der Notverordnung von 1931 eingeführte Pflichtprüfung, die bis heute als wichtige Errungenschaft im Aktienrecht gilt. „Der Erfolg oder Misserfolg von Reformgesetzen bedarf eigener Analysen“, resümiert Fleischer. „Unternehmensskandale sind kollektive Lernerfahrungen. Ihre systematisch-vergleichende Erforschung steht noch am Anfang. Für ihre Analyse lassen sich eine Reihe theoretischer Perspektiven fruchtbar machen. An Anwendungsfällen dürfte es ihr jedenfalls auch künftig nicht mangeln.“
Literatur
Holger Fleischer, Michael Zeller, Der FAVAG-Skandal und die Geburtsstunde der Abschlussprüfer
– Skandalgetriebene Regulierung in der Weimarer Republik, in: Festschrift für Walter Paefgen,
2025, 121-140.
Holger Fleischer, Gründerkrach, Gründerkrise und Gründerskandale im Kaiserreich, in:
Gedächtnisschrift für Gerald Spindler, 2025, 233-248.
Bildnachweise:
Headergrafik: Elemente aus © AdobeStock, accogliente und Loya.art
Porträt Holger Fleischer: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering