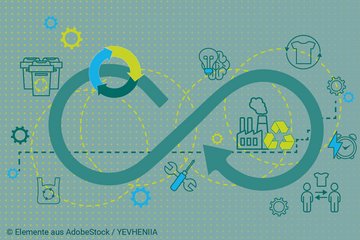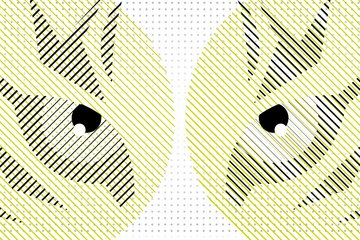Kindesentführung in Kriegszeiten
Warum sollten Kinder in ein Land zurückgeführt werden, in dem Krieg herrscht, wenn sie die Möglichkeit haben, an einem sicheren Ort zu bleiben? Diese Frage stellt Iryna Dikovska in ihrem kürzlich in ihrem Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ) erschienenen Aufsatz „Removal and Retention of Children in Times of War: The Hague Child Abduction Convention and the Case of Ukraine“.
Seit Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 waren Millionen Ukrainer*innen zur Flucht ins Ausland gezwungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Frauen und Kinder. Inzwischen verlangen immer mehr in der Ukraine verbliebene Väter die Rückführung ihrer Kinder auf Basis des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ). Das Verbringen eines Kindes unter 16 Jahren ins Ausland ohne Zustimmung des Vaters ist – sofern dieser das Sorgerecht hat – laut HKÜ grundsätzlich unrechtmäßig. „Ob es ein Unrecht darstellen kann, Kinder vor dem Krieg zu bewahren, bleibt angesichts der Situation in der Ukraine jedoch eine offene Frage“, sagt Dikovska. Sie untersucht in ihrem Aufsatz die Gründe, die dafürsprechen, die Rückführung von Kindern, die außerhalb der Ukraine Schutz gefunden haben, zu verweigern.

„Die Möglichkeit, ukrainischen Kindern, die im Ausland Schutz gefunden haben, eine Rückkehr in den Krieg zu ersparen, sollte immer Vorrang haben.“
– Iryna Dikovska –
So sieht Artikel 12 HKÜ vor, dass nach Ablauf eines Jahres nach dem Verbringen des Kindes ins Ausland eingegangene Anträge nicht zu berücksichtigen sind, falls das Kind sich erwiesenermaßen in seine neue Umgebung eingelebt hat. Dikovska verweist auf die Lebensrealität vieler von Flucht betroffener ukrainischer Kinder: „Die meisten von ihnen haben die Ukraine vor mehr als einem Jahr verlassen. Auch wenn sie vom Asylstaat aus online Kontakt zu ihrer Heimat halten oder ukrainischem Schulunterricht folgen, können sie in ihrer neuen Umgebung vollständig angekommen sein.“
Gemäß Artikel 13 HKÜ kann eine Rückführung unter anderem abgelehnt werden, wenn der Vater der Ausreise des Kindes zugestimmt hat. „Lautet die Abmachung der Eltern auf einen Aufenthalt im Ausland für die Dauer des Krieges, dann sollte vor Kriegsende auch keine Rückführung möglich sein.“ Ebenfalls abgelehnt werden kann die Rückführung, wenn mit ihr die schwerwiegende Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens für das Kind verbunden wäre. Trotzdem haben Gerichte verschiedener europäischer Länder in mehreren Fällen die Rückführung von Kindern in die Ukraine angeordnet, da diese, so die Begründung, im jeweils konkreten Fall in ein nicht von Kriegshandlungen betroffenes Gebiet erfolge. Dikovska betont: „Seit dem 24. Februar 2022 ist das gesamte Territorium der Ukraine Kriegsgebiet. Auch weit weg von der Front gibt es in der Zivilbevölkerung viele Tote und Verwundete.“
Artikel 20 HKÜ schließlich ermöglicht die Ablehnung der Rückführung, falls durch diese Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzt werden. Daraus leitet Dikovska ein weiteres Argument gegen die Rückführung von Kindern in die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt ab. Für die meisten Ukrainer*innen, die sich dauerhaft in einem EU-Staat aufhalten, gilt die EU-Richtlinie über vorübergehenden Schutz, die dem völkerrechtlichen Grundsatz des Non-Refoulement folgt. Dieser untersagt die Rückführung in Staaten, in denen den Betroffenen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. „Die Möglichkeit, ukrainischen Kindern, die im Ausland Schutz gefunden haben, eine Rückkehr in den Krieg zu ersparen, sollte immer Vorrang haben“, resümiert die Wissenschaftlerin.
Bildnachweis: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering