Das Institut in Zahlen
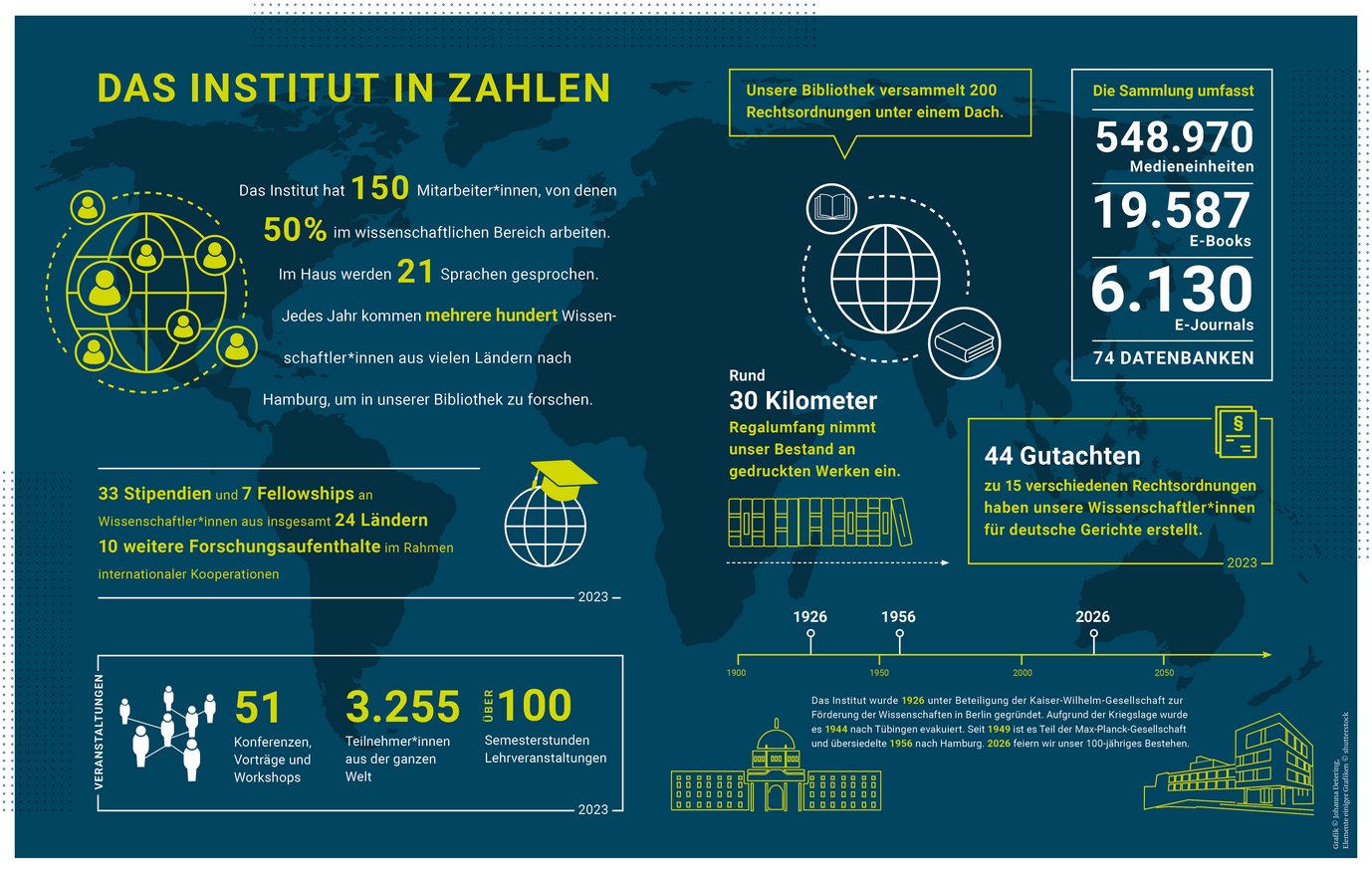
Infografik: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering;
Elemente einiger Grafiken: © shutterstock
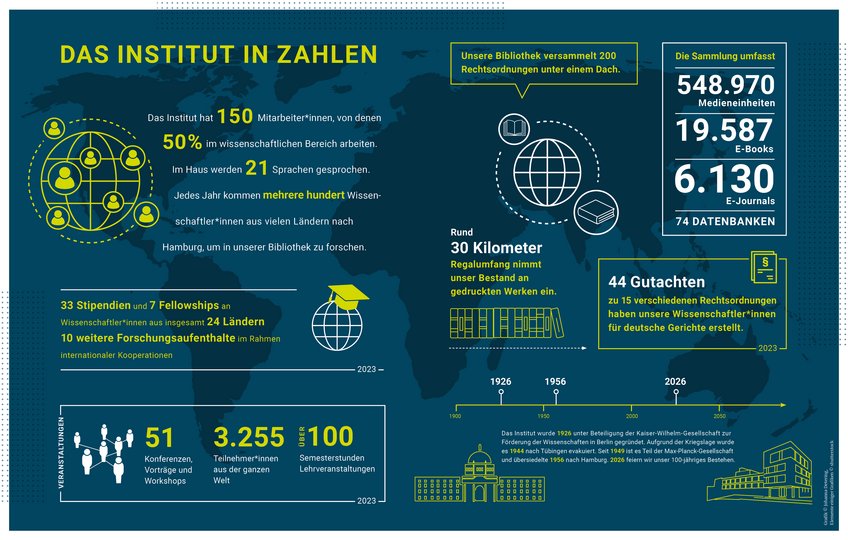
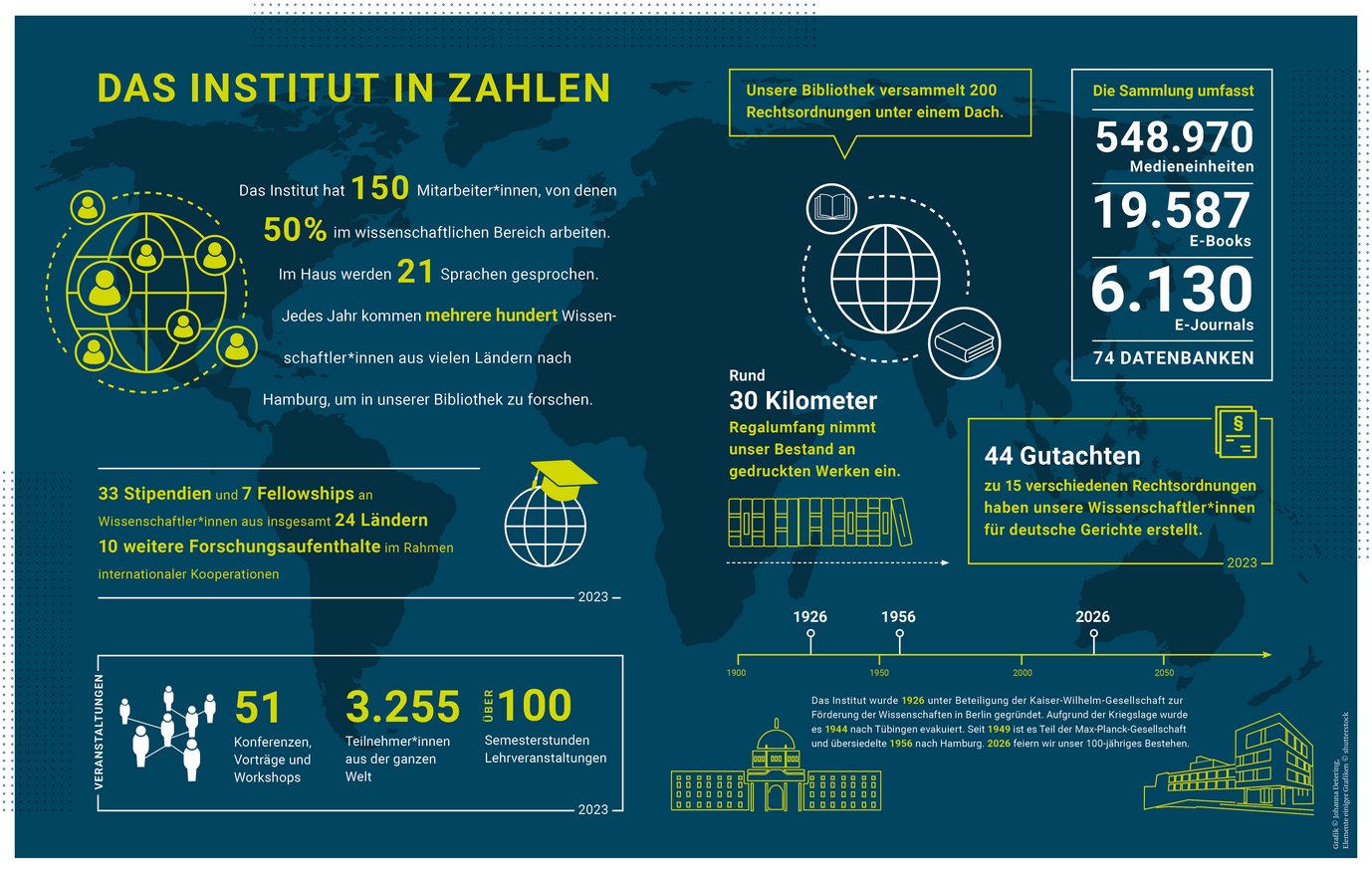
Infografik: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht / Johanna Detering;
Elemente einiger Grafiken: © shutterstock