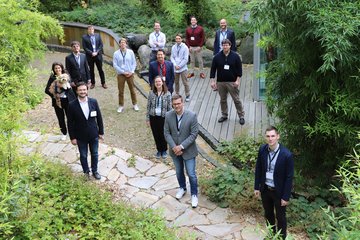Sportverbände und Menschenrechte – Zur Rolle von Corporate Social Responsibility und Athletenvereinigungen
Symposium des Forums für internationales Sportrecht
- Datum: 22.11.2021
- Uhrzeit: 17:00 - 20:00
- Ort: Hybrid-Veranstaltung
Am 22. November 2021 fand das Symposium des Forum für internationales Sportrecht am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg statt – erstmals als Hybridveranstaltung, nachdem das Symposium im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen war. Das Forum für internationales Sportrecht ist eine gemeinschaftliche Initiative des Max-Planck-Instituts für ausländisches und inter-nationales Privatrecht in Hamburg und des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München.
Sport, so heißt es, verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg. Ausgehend von diesem Prin-zip halten sich Sportverbände traditionell zurück, wenn es um politische Themen geht. Doch geraten sie immer wieder in Zugzwang. Die antirassistischen Streiks in den Sportligen der USA im Zeichen der „Black Lives Matter“-Demonstrationen sind dabei nur eines von vielen Beispie-len, die Themen wie Rassismus und Menschenrechte auf die Agenda der Sportverbände setzen. Übersetzt man die Debatte darüber in die Begriffe der Rechtswissenschaften, werden schnell Parallelen zur unternehmensrechtlichen Diskussion unter dem Sammelbegriff der Sozialverantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility – CSR) erkennbar. Wie es in der EU-Strategie der europäischen Kommission zu CSR heißt, geht es dabei im Kern um die Anerkennung der „Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“. Besteht diese Verantwortung auch für national und international organisierte Sportverbände? Wie sehen die CSR-Modelle der Sportverbände aus und wie gehen sie mit politischen Stellung-nahmen von Sportler*Innen um? Haben Sportler das Recht, Menschenrechtsverletzungen anzu-prangern und Abhilfe zu fordern oder müssen Sie rechtliche und sportliche Konsequenzen fürchten? Diesen und weiteren Fragen war das diesjährige Sportrechtssymposium gewidmet.
Begrüßung durch Institutsdirektor Reinhard Zimmermann
Professor Dr. Reinhard Zimmermann, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, eröffnete das Symposium mit einer mahnenden Tour d’Horizon zur Reichweite und Bedeutung des Veranstaltungsthemas. Die Verantwortung für sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele oder die Fußballweltmeisterschaft sei im Laufe der Geschichte wiederholt an Staaten vergeben worden, die Menschenrechte, wie z.B. die Meinungsfreiheit oder das Recht auf Diskriminierungsfreiheit, nicht achteten: Nazi-Deutschland 1936, China 2008 und 2022 (Olympische Spiele) oder Russland 2018 und Katar 2022 (Fußballweltmeisterschaft). Der Sport habe dabei zwar einerseits das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit auf politische Missstände gerichtet. Andererseits müsse aber die Nachhaltigkeit der dadurch erreichten Prangerwirkung in Frage gestellt werden.
Das Thema „Sportverbände und Menschenrechte“ betreffe darüber auch den Boykott von Athleten auf sportlichen Großereignissen. Zimmermann kritisierte die in Boykottaufrufen zum Ausdruck kommende Willkür und erinnerte an die Olympischen Spiele 1988 in Seoul, an denen Sportler des Apartheidstaats Südafrika nicht teilnehmen durften, während DDR-Sportler im gleichen Jahr (noch) zugelassen wurden, obwohl ihr Herkunftsstaat ebenso Unrecht verwirkliche und für ausgeprägte Dopingpraktiken bekannt gewesen sei. Betroffen gewesen sei u.a. ein mit Zimmermann befreundeter südafrikanischer Mittelstreckenläufer, der selbst in keiner Verbindung zum Apartheidregime stand. Die Sanktionierung von Menschenrechtsverletzungen werde insoweit auf dem Rücken der Sportler ausgetragen.
Schließlich seien deren Menschenrechte, insbesondere ihre Meinungsfreiheit auch selbst unmittelbarer Gegenstand der Agenda des Symposiums. Über Fragen zum Kniefall ganzer Sportmannschaften zur Unterstützung der „Black Lives Matter“-Bewegung gehe es auch um das Tragen regenbogenfarbener Kapitänsbinden (bspw. durch Manuel Neuer) oder antirassistische Gesten wie die erhobenen Black-Power-Fäuste von John Carlos und Tommie Smith bei der Siegerehrung zum 200m-Lauf in Mexiko 1968. Gesten wie diese lägen in Konflikt mit Regel 50 der Olympischen Charta und der vom IOC geforderten politischen Neutralität von Verbänden und Sportlern. Athletenvereinigungen wie Athleten Deutschland e.V. oder das Global Player Council setzten sich mittlerweile verstärkt für eine Reform der Charta ein. Wie man an der Satzung des DFB oder den FIFA Statuten erkennen könne, seien durchaus Fortschritte zu verzeichnen. Auch auf olympischer Ebene gebe es Vorschläge, die UN-Leitlinien für unternehmensbezogene CSR-Modelle auf menschenrechtliche Problemlagen in Sportverbänden zu übertragen. Dieser Trend bilde den Ausgangspunkt für den Zuschnitt des Symposiums. Zimmermann schloss die Begrüßung mit der Vorstellung der Referenten und übergab das Wort an Professor Mathias Habersack.

Hauptvortrag von Mathias Habersack, Ludwig-Maximilians-Universität München
Professor Mathias Habersack hob zunächst ebenfalls die Vielschichtigkeit und Bedeutung des Veranstaltungsthemas hervor und verwies auf dessen Ursprünge in der seit einigen Jahren intensiv geführte Debatte um die Gemeinwohlbindung privater Akteure, insbesondere kapitalmarktorientierter Aktiengesellschaften unter dem Stichwort CSR.
Es folgte ein Überblick über den rechtlichen Rahmen der Diskussion. Ausgangspunkt von Menschenrechtsfragen sei auf nationaler Ebene das Grundgesetz; aus dem erforderlichen internationalen Blickwinkel seien es allerdings auch die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte, die auf den nach John Ruggie benannten Ruggie-Principles und dessen Konzept von protect, respect und remedy basierten. Die Schwierigkeit liege darin, dass diese Leitlinien keine unmittelbare Geltung im Privatrechtsverkehr beanspruchten. Im Gesellschaftsrecht wurzle die CSR-Debatte in den Berichtspflichten aus §§ 289b ff. HGB für kapitalmarktorientierte Kapitalgesell-schaften, die eine sog. nicht-finanzielle Erklärung forderten. Darin gehe es unter anderem um unternehmensseitige Konzepte in Bezug auf Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelange und um eine Erklärung zur Achtung von Menschenrechten. Diese Berichtspflicht setze allerdings keinerlei inhaltliche Maßstäbe und könne deshalb auch durch eine – freilich erläuterungsbedürftige – „Fehlanzeige“ erfüllt werden. Hinter diesem Konzept stehe nämlich vor allem die Idee, dass die Marktgegenseite (z.B. Investoren, Kunden aber auch Arbeitnehmer) die Ausrichtung des Unternehmens bewerten können soll, um eigene Entscheidungen auf informierter Grundlage treffen zu können. Demgegenüber statuiere bspw. das neue Lieferkettensorgfaltspflichtenge-setz nicht nur Berichtspflichten, sondern wirkliche menschenrechts- und umweltbezogene Sorgfaltspflichten, eine behördliche Berichtsprüfung und echte Sanktionsmechanismen.
Dies werde flankiert von der unsichtbaren Hand des Wettbewerbs, die sich in der Erwartungshaltung und dem Einfluss institutioneller Investoren und Kreditgeber niederschlage. Diese zögen sich von bestimmten Industrien zurück, weil das Verlangen nach einem Unternehmenszweck (corporate purpose) jenseits der Gewinnerzielung sich auch in deren Strategie realisiert habe. Paradigmatisch seien die warnenden Ankündigungen des BlackRock-Gründers Larry Fink, große Investitionen zu überdenken, wenn Unternehmen und Unternehmensleiter nicht auf ihre Rolle in Umwelt und Gesellschaft achteten. Nichts anderes gelte für den Bereich der Arbeitnehmer. Hinzu trete dann auch die EU-Politik, namentlich der Kommission, die im Aktionsplan 2018 die Förderung einer nachhaltigen Unternehmensführung und den Abbau von short-termism an den Kapitalmärkten auf die politische Agenda setze. Dieser sanfte politische und wirtschaftliche Druck fließe nach der herrschenden Lesart des Gesellschaftsrechts auf rechtlicher Ebene in die unternehmerischen Entscheidungen von Gesellschaftsorganen ein, die neben monetären Investoreninteressen auch Reputationsrisiken des Unternehmens zu berücksichtigen hätten.
Sportverbände würden allerdings weder von den geltenden CSR-Regeln noch vom Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz erfasst. Wegen der Vorbildfunktion der Sportler*Innen unterlägen sie aber gleichwohl gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf Menschenrechte oder ökologische Aspekte. Insoweit seien in letzter Konsequenz die Mitglieder und die für die Erstellung der Verbandsstatuten verantwortlichen Gremien für die Positionierung der Verbände verantwortlich; im Rahmen der bestehenden Statuten zudem die Verbandsfunktionäre, die über die sportpolitischen Entscheidungen im Einzelnen zu befinden hätten.
Habersack richtete sodann einen kurzen vergleichenden Seitenblick auf die Debatte um Environmental Social Governance (ESG). Auch dieses Thema nehme im Recht der börsennotierten Gesellschaften mittlerweile eine herausragende Rolle ein und gehe durch die Einbeziehung von Umweltbelangen und Governance-Fragen deutlich über CSR hinaus. So bestünden mittlerweile umfassende und weitreichende Transparenzpflichten und zwingende Governance-Regeln, um eine interne und externe Kontrolle des Unternehmens sicherzustellen. Das Recht der Sportverbände weise hier, auch und gerade in der Debatte um den Umgang mit Menschenrechtsverletzungen ein signifikantes Defizit auf: Es gäbe keine zwingenden Governance- oder Transparenzpflichten. So fehle etwa jede Kontrolle im Bereich der Vergütung der Funktionäre. Demgegenüber sei die Vergütungskontrolle durch Investoren in börsennotierten Gesellschaften nicht nur möglich sondern finde auch tatsächlich statt. Die Vergütungen der Organe von börsennotierten Gesellschaften sowie die Vergütungsstrukturen seien in allen Details transparent und gerade letztere fielen bei der Kontrolle durch die Aktionäre nicht selten durch, weil den Investoren die darin zum Ausdruck kommenden Anreizstrukturen missfallen. All das fehle im Recht der Sportverbände.
Im zweiten Teils seines Referats, hielt Habersack zunächst fest, dass politisches Engagement von Sportverbänden als solches nicht nur nicht zu beanstanden, sondern sogar erwünscht und unerlässlich sei. Es sei in erster Linie eine Frage des Verbandszwecks und statutarischer Vorgaben, inwieweit sich ein Verband in politischen Zusammenhängen engagieren dürfe aber auch müsse. Denn an den Statuten müsse sich das Verhalten des Verbands und der Verbandsorgane und Mitglieder messen lassen. Das politische Engagement eines Verbands zu definieren sei also regelmäßig Aufgabe der Mitglieder; bestehende Statuten seien nicht in Stein gemeißelt. Öffentlich-rechtliche Schranken politischer Betätigung, deren Bedeutung für die Menschenrechtsdebatte Habersack vorsichtig in Zweifel zog, blieben im Übrigen unberührt. Regelungen wie das Vereinsverbot nach dem Vereinsgesetz könnten aufgrund ihrer Ratio, die bei sog. Auslandsvereinen auch auf den Gedanken der Völkerverständigung rekurriere, gerade für die Beurteilung von Boykott-Entscheidungen von Relevanz sein.
Im Hinblick auf das Engagement von Sportler*Innen müsse zwischen Engagement außerhalb und innerhalb von Sportveranstaltungen differenziert werden. Jedenfalls Ersteres sei „Privatsa-che“ und rechtlich nicht zu beanstanden, solange die Grenzen der Meinungsfreiheit eingehalten würden. Für letzteres sei der rechtliche Ausgangspunkt in den jeweiligen Verbandsregeln und Athletenvereinbarungen zu sehen. So sehr es zu begrüßen wäre, wenn Verbände das Bekenntnis zu Menschenrechten auch im Rahmen sportlicher Veranstaltungen zwingend erlauben würden, müsse man anerkennen, dass die Grenzziehung bei Auslegung und Anwendung der Statuten im Einzelfall durchaus schwierig sei: Welches Verhalten können Funktionäre den Sportler*Innen nach den geltenden Statuten erlauben und welches Verhalten ist von einem Verbotstatbestand eindeutig umfasst? Da von Verband zu Verband z.T. große Unterschiede zu verzeichnen seien, könne keine allgemeingültige Aussage darüber getroffen werden, ob die von Athleten- und Spielervereinigungen geäußerten Forderungen schon auf der Grundlage der geltenden Statuten umgesetzt werden können.
Ferner sei problematisch, dass es in zentralen politischen Fragen weder einen Welt- noch EU-weiten Konsens gebe. Die Folge von politischem Engagement auf sportlichen Großereignissen seien deshalb häufig heftige Gegenreaktionen, die in einen Überflügelungswettbewerb im Meinungsaustausch münden könnten. Auch deshalb sei die Forderung politischer Enthaltsamkeit in Statuten oder Athletenvereinbarungen rechtlich nicht zu beanstanden, weil sie sich als Ergebnis einer Interessenabwägung rechtfertigen ließe: Angesichts der für jeden Sportler unzweifelhaft bestehenden Freiheit zu einem Engagement außerhalb der konkreten Veranstaltung überwiege das Interesse der Verbände an der sicheren und reibungslosen Veranstaltung das Interesse der Sportler*Innen sich gerade in dieser konkreten Veranstaltung politisch zu engagieren oder zu äußern. Für Sportverbände gehe es um die Veranstaltung als Ganzes, für die Sporler*Innen hingegen lediglich um eine konkrete Form der Meinungsäußerung oder des Engagements. Habersack bekräftigte diese Würdigung durch Hinweis auf anerkannte arbeitsrechtliche Grundsätze aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, das das Interesse des Arbeitgebers am Betriebsfrieden und Betriebsablauf als schutzwürdigen Belang im Zusammenhang mit dem Verbot politischen Engagements am Arbeitsplatz anerkenne, sowie auf bestehende Judikatur des Bundesgerichtshofs zu Schiedsvereinbarungen in Athletenvereinbarungen (Causa Pechstein).
In seinem Fazit resümierte Habersack, dass bei aller Sympathie, die für Menschenrechtsengagement angezeigt sei, in erster Linie die Verbände und die für deren Willensbildung maßgeblichen Gremien zu dessen Ermöglichung aufgerufen seien. Solange die Verbandsstatuten ein gesellschaftspolitisches Engagement und die Bekundung von Meinungsäußerungen verböten, sei dies rechtlich hinzunehmen.
Kommentar von Johannes Herber, Basketballspieler und Geschäftsführer von Athleten Deutschland e.V
Johannes Herber, von 2004 bis 2011 Basketballnationalspieler und mittlerweile Geschäftsführer der Vereinigung Athleten Deutschlang e.V., beschrieb sodann die Perspektive der Sportler*Innen. Herber stellte zunächst zwei Gründe für die Beschäftigung von Sportler*Innen mit Menschenrechten heraus. Erstens sei man zunehmend dafür sensibilisiert, dass große sportliche Wettbewerbe in verschiedenster Weise zu Menschenrechtsverletzungen führten. Als Teilnehmer wolle man diese Missstände nicht länger hinnehmen. Zweitens erlaube der Sport den Blick auf Menschenrechtsverletzungen durch ein gänzlich neues Prisma, namentlich durch den Blick auf die Rechte der Athlet*Innen. Die Problemfelder reichten von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft über Gewalt- und Missbrauchserfahrungen (auch Minderjähriger) bis hin zu Eingriffen in die Meinungsfreiheit, die Privatsphäre, die Unverletzlichkeit der Wohnung oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (z.B. im Anti-Doping Bereich). Daneben bestünden Defizite und Diskrepanzen im Hinblick auf ILO-Kernarbeitsnormen, den Zugang zur Schiedsgerichtsbarkeit und der Vereinigungsfreiheit.
Ein großes Problem sehen Herber und Athleten Deutschland e.V. im Fehlen eines rechtlichen Rahmens für Athletenrecht. Das gelte sowohl für den abstrakt-generellen Bereich des Gesetzes als auch für die individuellen Athletenvereinbarungen, deren Vereinbarungscharakter Herber pointiert in Frage stellt. Diese „Vereinbarungen“ dienten eher der einseitigen Aushöhlung der Athletenrechte, als dass sie solche begründeten. Abgesehen von dem Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit enthielten die einschlägigen Verbandsstatuten keinerlei handfeste Maßstäbe, sondern häufig nur schwer greifbare Verweise auf fundamentale Prinzipien (wie das „solidarische Zusammenwirken“ oder das „humanistische Menschenbild“).
Gleichermaßen problematisch sei das bloß reaktive Agieren der Sportverbände. Eine Lösung dieses Problems wäre nach Herber ein proaktives Bekennen der Sportverbände zu den UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte; so wie es die FIFA bereits getan habe. Dafür seien vier Schritte erforderlich: (1) eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte, (2) die Identifikation der Problemfelder im Sinne einer human rights due diligence, (3) Bestimmung von wirksamen und kontrollierbaren Maßnahmen zur Problembewältigung und (4) die Einführung einer Berichterstattung und eines Beschwerdemechanismus. Zu letzterem merkte Herber kritisch an, dass auch die Konfliktlösung vor dem internationalen Sportgerichtshof (CAS) den Anforderungen der UN-Leitlinien an einen wirksamen Beschwerdemechanismus keinesfalls vollständig entspreche.
Kommentar von Sylvia Schenk, Transparency International Deutschland und Menschenrechtsanwältin

Sylvia Schenk, Juristin und ehemalige Leichtathletin, von 2017 – 2020 Mitglied im Menschen-rechtsbeirat der FIFA, berichtete zunächst eindrucksvoll aus ihrer langjährigen Beschäftigung mit Menschenrechtsverletzungen im Sport. Ihr Kommentar korrigierte gleich zu Beginn das Verständnis des CSR-Begriffs: Es gehe um Verantwortung im Kerngeschäft der Sportverbände, nicht um politisches Engagement oder gezielte Charity-Aktionen – in puncto Menschenrechte gelte: do no harm! Wenn eine Favela in Brasilien in ein Olympisches Dorf verwandelt würde und die Bewohner ohne ausreichenden Ersatz vertrieben würden, dann sei das IOC unmittelbar (mit-) verantwortlich für diese Menschenrechtsverletzung. Ein Ausgleich dafür könne nicht durch die Zulassung eines Refugee-Teams in den olympischen Wettbewerben herbeigeführt werden.
Menschenrechtsfragen seien keine einfachen und forderten und letztlich immer eine Abwägung – apodiktische Schwarz-Weiß-Lösungen funktionierten nicht. Während Frauen im Basketball und Fußball mittlerweile auf oberster Wettkampfebene im Hidschāb antreten dürften, fordern Feminist*innen in Frankreich – ein westlich-laizistisches Land – dies den Athletinnen bei den Spielen in Paris 2024 zu verbieten. Schwierige Abgrenzungsfragen zu Fairness, Inklusion oder Antidiskriminierung stellten sich bspw. in Bezug auf Transgender: Wer darf bei den Frauen starten, wer nicht? Eine absolut gerechte Lösung gebe es in diesem Bereich nicht. Entscheidend sei ein angemessener und fairer Umgang gegenüber den Betroffenen.
Bei politischen Stellungnahmen stünden Verbände vor demselben Problem. Schenk nannte das Beispiel der zur Zeit des Symposiums vermissten chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai. Sei es hier richtig, dass die WTA durch den Abzug von Turnieren aus China politischen Druck ausübe, oder sei mit Blick auf die chinesische Landeskultur "stille Diplomatie" wirkungsvoller? Hier könne man viel falsch machen und deshalb sei immer eine umfassende Abwägung angezeigt.
Die FIFA habe mittlerweile verstanden, dass die Verantwortung der Sportverbände sich auf den gesamten Lebenszyklus eines sportlichen Großereignisses beziehe. In der Folge seien für die Organisation der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auch endlich die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte angewendet worden. Auch wenn wir noch nicht da seien, wo wir sein müssten in der Umsetzung (zum Beispiel in einzelnen Fällen bei der Auszahlung von Löhnen), habe sich tatsächlich schon viel getan. Es sei auch nicht zu unterschätzen, dass die Vergabe der Fußball-WM es vielen Menschenrechtsorganisationen erst ermöglicht habe, politischen Druck auf Katar auszuüben.
Schenk leitete über zu einer für sie zentralen Frage: Welche Rolle könne der Sport spielen, um seiner letztlich diplomatischen Funktion der Völkerverständigung nachzukommen, aber gleichzeitig eine Haltung in Bezug auf Menschenrechtsfragen zu beziehen ohne sich instrumentalisie-ren zu lassen? Schenk plädiert für einen Mittelweg im Sinne einer „Ping-Pong-Diplomatie 2.0“.
Im Bereich des Engagements der Athlet*innen sei schließlich ebenfalls zu differenzieren: Politische Propaganda zu konkreten Einzelfragen (zum Beispiel Pro und Contra Fristenlösung bei Abtreibungen) gehöre nicht auf eine Siegerehrung. Anders sei dies beim Einsatz für fundamentale Menschenrechte wie Antidiskriminierung. Hier lägen Athleten auf einer Linie mit den in zahlreichen Verbandsstatuten niedergelegten Grundwerten des Sports und der Sportverbände. Kniefall und Regenbogenbinde seien zu akzeptieren. Der Sport könne emotionale, hoffnungsfrohe und wirkungsvolle Bilder schaffen, was eine große Chance darstelle.
Kommentar von Christoph Becker, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Christoph Becker, Sportredakteur der FAZ, erhielt als dritter Kommentator das Wort, um die Menschenrechtsverantwortung von Sportverbänden aus journalistischer Sicht zu beleuchten und die Beiträge der Vorredner*Innen zu reflektieren. Die Themen, die heute medienwirksam diskutiert würden, seien in der Sache keine Themen des 21. Jahrhunderts. Allerdings sei der politische Druck in den vergangenen 15 Jahren durch die Vergabe von Großveranstaltungen an China, Russland, Brasilien oder Katar exorbitant gestiegen.
Becker illustrierte diese Entwicklung mit einem anregenden Streifzug durch die Schlagzeilen der vergangenen Jahre. Der Grund für diese Vergabepraxis liege aber nicht in einer politischen Agenda zur Anprangerung von Menschenrechtsverletzungen in diesen Staaten, sondern auch darin, dass häufig keine anderen geeigneteren Bewerber für die Austragung zur Verfügung standen. Becker berichtete über ein Interview, dass er mit John Ruggie im Dezember 2015 anlässlich der Erstellung der Human Rights Policy der FIFA im Jahr 2016 geführt habe. Dieser habe eindrücklich auf die Vielschichtigkeit der CSR-Gesichtspunkte bei der Durchführung großer Sportveranstaltungen hingewiesen. Wollten Verbände eine glaubwürdige Policy aufstellen, müssten sie etliche Fragen klären: Nach welchen Standards werden Stadien errichtet? Werden Umsiedlungen rechtskonform durchgeführt? Wie sind Arbeitsbedingungen bei Lizenznehmern, Trikot- und Merchandise-Herstellern? Wurden Hotelbetreiber auf den Anstieg von Menschenhandel und Prostitution durch ansteigenden Tourismus hingewiesen? Eine vollständige Kontrolle durch die Verbände sei in Bezug auf all das kaum denkbar.
Großes Potenzial sieht Becker bei den Athletenvereinigungen. Die Organisation von Sportler*Innen in den USA könne hier als Vorbild dienen. Die „Spielergewerkschaft“ der National Basketball Players Association (NBPA) habe beispielsweise bei der Verhandlung über die Ausrichtung des Fortsetzungsturniers nach dem pandemiebedingten Ende der laufenden Saison eine Reihe von Forderungen durchsetzen können. So wurde vom Verband zugestanden, dass Spieler im Turnierbetrieb – teilweise wurde dieser extra unterbrochen – Banner der „Black Lives Mat-ter“-Bewegung und auf ihrer Sportkleidung Schriftzüge mit eindeutigen politischen Stellungnahmen präsentieren durften. Dem stellte Becker das Beispiel von Nike Lorenz gegenüber. Ihre Regenbogenfarbenkapitänsbinde sei zwar unter der Geltung von Regel 50.2 der Olympischen Charta akzeptiert worden. Allerdings sei dem ein Antrag von Lorenz vorausgegangen, der zur Verschiebung der Verantwortung hin zu nationalen olympischen Verbänden geführt habe. Dies führe – was Becker bedauerte – zur Geltung unterschiedlicher Regeln für unterschiedliche Nationen. Damit sei es für Sportler*Innen wie Journalist*Innen nicht nur unklar, welche Gesten und Symbole erlaubt seien, sondern auch, wer darüber entscheidet. Die unzähligen gleichartigen Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigten, dass auch in Zukunft daher ein Anstieg der Betroffenheit der Sportler zu erwarten sei.
Becker schloss seinen Vortrag mit einer Aufforderung an die großen Verbände, insbesondere das IOC, sich bald und deutlich zu positionieren und einem Ausblick auf künftige Fragen der Durchsetzbarkeit und des effektiven Rechtsschutzes in Bezug auf Menschenrechtspositionen von Sportverbänden.