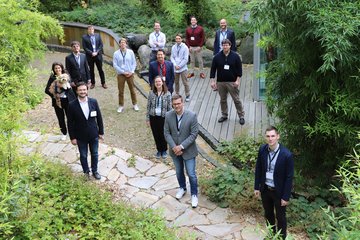Symposium zum Jahrestreffen des Vereins der Freunde 2019
Thema: Akademische Karrrierewege / Academic Career Paths
- Datum: 29.06.2019
- Uhrzeit: 10:00 - 18:15
Am 29.Juni 2019 fand das Jahrestreffen des Vereins der „Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts“ in Hamburg statt. Unter dem Titel „Akademische Karrierewege“ setzten sich Referenten und Gäste damit auseinander, auf welche Weise die Rechtswissenschaft in verschiedenen Länder ihren Nachwuchs rekrutiert, welche Vor-und Nachteile dabei zu beobachten sind und ob sich Besonderheiten der jeweiligen Rechtsordnungen in diesen Karrierewegen widerspiegeln.
Einführung: Akademische Karrierewege in den USA

In seiner Einführung wies Reinhard Zimmermann (Hamburg) darauf hin, dass sich die rechtsvergleichende Forschung bisher eher wenig damit befasst habe, wie der akademische Nachwuchs in unterschiedlichen Rechtsordnungen rekrutiert wird. Beispielhaft skizzierte er sodann den Weg, den junge US-Amerikaner zu beschreiten haben, wenn sie Professor an einer Law School werden wollen. In Anlehnung an einen Aufsatz von James Gordley, der 1993 im American Journal of Comparative Law erschienen ist, beschrieb er das zentrale Kriterium als „mere brilliance“. Diese Brillanz drückt sich typischerweise darin aus, dass der Kandidat zunächst eines der prestigeträchtigsten Colleges besucht und dieses als einer der besten fünf Prozent des Jahrgangs abgeschlossen hat. Sodann folgt der Besuch einer der prestigeträchtigsten Law Schools. Hier sollte der Bewerber wieder unter den besten fünf Prozent landen und idealerweise editor in chief der Law Review gewesen ist. Auf die Zeit an der Law School folgt ein clerkship, und zwar zunächst bei einem Bundesrichter der Eingangs-oder Berufungsinstanz und dann bei einem Richter des US Supreme Court. Danach steht die Bewerbung als Assistant Professor offen, was zu dem aus deutscher Sicht bemerkenswerten Ergebnis führt, dass Personen zum Assistant Professor ernannt werden können, die nur wenig oder überhaupt nicht publiziert haben. Allerdings spielt im nächsten Schrit tdie Veröffentlichung des „tenure piece“ die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ob die Person tenure erhält, also eine unbefristete Professur. Zum Schluss merkte Zimmermann an, dass in den USA derzeit in mancher Hinsicht ein Wandel stattfindet. So hatten z.B. frühere Generationen von Hochschullehrern fast nie einen Ph.D.-Abschluss. Heute spielt dieser demgegenüber eine größere Rolle, wobei der Ph.D. oft nicht in Jura, sondern einem benachbarten Fach (z.B. Wirtschaftswissenschaften) erworben wird.
Deutschland und Österreich

Nach dieser Einführung und dem Blick in die USA sprach Walter Doralt (Graz) über akademische Karrierewege in Deutschland und Österreich. Während sich die wesentlichen Etappen in Deutschland und Österreich gleichen – Jurastudium, Promotion und Habilitation – bestehen Unterschiede im Detail. Ein Unterschied liegt darin, dass das Referendariat in Österreich fünf Jahre dauert, weshalb die meisten Kandidaten, die in die Wissenschaft streben, hierauf verzichten. Daher erfüllen Habilitanden in Österreich in der Regel nicht die Voraussetzungen, um zur Anwaltschaft zugelassen zu werden, was im Vergleich zu Deutschland dazu führt, dass ein Sicherheitsnetz fehlt: Scheitert die akademische Karriere, ist in Deutschland ein Wechsel in die Anwaltschaft oder in den Richterberuf möglich, nicht aber in Österreich. Weitere Unterschiede bestehen in Bezug auf Lehrstuhlvertretungen und das Verbot von Hausberufungen. Während Lehrstuhlvertretungen in Österreich unüblich sind, wird das Verbot der Hausberufungen dort flexibler gehandhabt, schließlich ist Österreich ein kleines Land mit einem kleinen Bewerbermarkt. In der anschließenden Diskussion ging es vor allem um die Frage, ob Promotionen und Habilitationen in Deutschland und Österreich zu oft über dogmatischeThemen des nationalen Rechts geschriebenen werden. Doralt gab zu bedenken, dass es gerade bei einer kleinen Rechtsordnung wie der österreichischen nicht wünschenswert ist, wenn Monografien ausschließlich zur Dogmatik des österreichischen Rechts geschrieben werden und daher für die außerösterreichische Diskussion nicht anschlussfähig sind.
Klaus Hopt (Hamburg) teilte die Kritik an einer übermäßigen Fokussierung auf die Dogmatik, gab aber zugleich zu bedenken, dass der Verzicht auf die Anbindung an ein nationales Recht zu einem Verlust der Bodenhaftung führen kann. Birgit Grundmann (Berlin) ergänzte aus der Perspektive ihrer Erfahrungen im Bundesministerium der Justiz, dass nationale Dogmatik insbesondere im Umgang mit dem Europarecht nicht weiterhelfe, weil das Europarecht keiner nationalen Dogmatik gehorcht. Schließlich berichtete Thomas Koller (Bern), dass in der Schweiz ebenfalls Promotion und Habilitation Voraussetzung für die Berufung auf einen Lehrstuhl sind, darüber hinaus aber auch großer Wert auf Praxiserfahrung gelegt werde.
Frankreich
Sodann trug Samuel Fulli-Lemaire (Paris) über die zwei Wege vor, die in Frankreich auf eine Professur führen. Der erste Weg zeichnet sich dadurch aus, dass er im Vergleich zu Deutschland und Österreich kurz ist und schnell durchlaufen werden kann. Direkt nach der Promotion, die in Frankreich allerdings in der Regel etwas länger dauert, können junge Wissenschaftler am zentralen Bewerbungsverfahren teilnehmen, das im Privatrecht alle zwei Jahre stattfindet und als agrégation bezeichnet wird. Dieses Verfahren besteht aus vier Prüfungen, in denen die Bewerberzahl nach und nach von über zweihundertauf die zu vergebenden zwanzig bis dreißig Stellen reduziert wird. Die aus der Außenperspektive wohl ungewöhnlichste Prüfung besteht dabei in einer Vorlesung, die in 24 Stunden vorbereitet werden muss, wobei der Kandidat von einer équipe unterstützt wird, die er selbst zusammenstellt und anleitet. Hierbei zeigt sich ein Problem der agrégation, nämlich die Ungleichbehandlung von Kandidaten aus Paris im Vergleich zu Kandidaten aus der französischen Provinz. Die agrégation findet immer in Paris statt, sodass die Pariser Kandidaten auf eine équipe vor Ort bauen können. Auswärtige Kandidaten müssen ihre équipe hingegen nicht nur zu einer Reise nach Paris motivieren, sondern auch für deren Transport und Unterbringung aufkommen.

Während der Weg über die agrégation – die sogenannte „voie royale“ – dazu führen kann, dass jemand mit Ende zwanzig Professor ist, gibt es auch einen zweiten Weg, derals „voie longue“ bezeichnet wird. Dieser Weg führt nach der Promotion über mindestens fünf Jahre als maître de conférence, d.h. als Lehrbeauftragter mit fester Anstellung, zu einer Professur. Obwohl die „voie longue“ als weniger prestigeträchtig gilt als die „voie royale“, ist die Berufung eines Kandidaten über die „voie longue“ für die Fakultäten vorteilhaft, denn hier können sie sich die Kandidaten aussuchen. Nach der agrégation entscheiden hingegen die erfolgreichen Bewerber, an welche Fakultät sie gehen möchten. Eine besondere Stellung nimmt hierbei der Erstplatzierte ein, der nicht nur zuerst wählen darf, sondern auch die Verteilung der übrigen freien Stellen koordinieren muss.
In der anschließenden Diskussion wurdedarüber gesprochen, ob das französische System zu einem höheren Anteil von Frauen in der Professorenschaft führt, weil es im Gegensatz zum deutschen Habilitationssystem die Möglichkeit eröffnet, in den frühen Dreißigern eine Professur zu erhalten, was Sicherheit und Planbarkeit gibt. Fulli-Lemaire wandte dagegen ein, dass in der letzten agrégation zwar unter den Bewerbern gleich viele Frauen und Männer waren, aber am Ende nur fünf der 26 Stellen an Frauen vergeben wurden. Dies könne auch daran liegen, dass der Erfolg in der agrégation von einer souveränen Selbstvermarktung abhänge, die Männern aufgrund überkommener Rollenbilder zuweilen leichter falle. Während die geschilderten Bevorzugung von Pariser Bewerben in der agrégation schon seit längerem als negativ wahrgenommen wurde, kommt heute als Kritikpunkt hinzu, dass es dem Verfahren nicht gelinge, Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen herzustellen.
Italien

Als nächster Redner schilderte Francesco Paolo Patti (Mailand) die Lage in Italien. Bis 1998 gab es in Italien ein System, das der französischen agrégation ähnelte, weil alle Stellen in einem zentralen Verfahren in Rom vergeben wurden. Dies führte zu Unzufriedenheit in den Fakultäten, wo man sich die neuen Kollegen selbst aussuchen wollte. 1998 kam es zu einer Dezentralisierung des Systems, was zu einer übermäßigen Bevorzugung von Kandidaten aus der eigenen Fakultät führte, weil es kein Verbot der Hausberufung gibt. Seit 2010 beschreitet Italien einen Mittelweg, indem Professuren nur an Kandidaten vergeben werden können, die in einem zentralisierten Verfahren die abilitazione scientifica erhalten haben. Das eigentliche Auswahlverfahren (concorso) findet weiter in Eigenregie der Fakultäten statt, was dazu führt, dass viele concorsi auf einen Kandidaten zugeschnitten sind, der bereits als Nachwuchswissenschaftler an der Fakultät arbeitet. Die Teilnahme am concorso einer anderen Universität gilt daher oft als aussichtslos. Der Weg zur abilitazione führt in Italien über die Promotion, die in der Regel in drei bis vier Jahrenerstellt wird. Hieran schließt sich eine befristete Stelle als ricercatore an. Während dieser Phase muss die Dissertationsschrift veröffentlicht werden, weil die Veröffentlichung einer Monographie Voraussetzung dafür ist, die abilitazione zu erhalten. Mit der abilitazione steht die Teilnahme an einem concorso offen, um professore associato zu werden. Während der Zeit als professore associato sollte eine zweite Monographie entstehen, die anders als die deutsche Habilitationsschrift nicht länger, sondern in der Regel kürzer als die Dissertation ausfällt. Die letzte Stufe ist schließlich die Berufung zum professore ordinario, die wegen der vielen vorhergehenden Schritte zumeist erst in den Vierzigern erreicht wird.
Angeregt durch diese Schilderungen ging es in der anschließenden Diskussion vor allem um das Verbot der Hausberufung und den Wechsel der Universität. Weil Hausberufungen in Italien nicht nur nicht verboten, sondern die Regel sind, gibt es kaum personellen Austausch zwischen den Fakultäten und daher auch kaum Konkurrenz um die besten Köpfe. Entsprechend gibt es in Italien keine Bleibeverhandlungen. In Deutschland erfülle das Verbot der Hausberufung hingegen einen guten Zweck, denn – gab Reinhard Zimmermann zu bedenken – es sei faktisch unmöglich, Chancengleichheit zwischen einem Kandidaten aus der eigenen Fakultät und einem externen Kandidaten herzustellen. Das Verbot der Hausberufung schränke allerdings die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein, weil Lebenspartner heute in der Regel eine eigene Karriere verfolgen und daher nicht ohne weiteres zu einem Umzug bereit sind.
Vereinigtes Königreich

Sodannberichtete Andrew Sweeney (Edinburgh/Hamburg) über akademische Karrierewege im Vereinigten Königreich, wobei er vor allem auf Schottland einging. Anders als die deutschen, österreichischen, französischen und italienischen Fakultäten werden die rechtswissenschaftlichen Fakultäten im Vereinigten Königreich von Nachwuchssorgen geplagt. Der Hauptgrund hierfür liegt im Finanziellen: „It’s a very costly business to become an academic.“ Zum einen ist der Erwerb eines Ph.D. mittlerweile faktisch Voraussetzung dafür, zunächst lecturer und dann Professor zu werden. Die Teilnahme an einem Ph.D.-Programm kostet aber zum Teil hohe Studiengebühren, und es gibt nur wenige Stipendien zur Finanzierung. Zum anderen konkurriert die Wissenschaft mi tder Anwaltschaft, die mit üppigen Einstiegsgehältern lockt. Viele talentierte Studenten ziehen daher eine Karriere in der Praxis vor oder entscheiden sich sogar noch nach Erwerb des Ph.D.dazu, der Wissenschaft abspenstig zu werden. Dieser Mangel an Nachwuchswissenschaftlern hat dazu geführt, dass britische Universitäten zunehmend Nachwuchskräfte aus dem Ausland anwerben. Das kann vor allem für eine kleine Rechtsordnung wie die schottische problematisch sein, weil Wissenschaftler aus dem Ausland in der Regel nicht in der Lage sind, schottisches Recht zu unterrichten und zum schottischen Recht zu forschen. Das wäre aber nötig, um die schottischen Studenten auf die Praxis vorzubereiten und zugleich die wissenschaftliche Durchdringung des schottischen Rechts voranzutreiben.
Die anschließende Diskussion drehte sich vor allem um die Verbindung zwischen Rechtswissenschaft und -praxis. So können sich in Schottland Rechtswissenschaftler auf zahlreiche Weisen in die Rechtspraxis einbringen, z.B. als Mitglied der schottischen Law Commission oder als counsel in einer Anwaltskanzlei. Zugleich nehmen Rechtswissenschaftler durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten Einfluss auf die Praxis. Der enge und erwünschte Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis kreiert indes die geschilderte Gefahr, dass Nachwuchswissenschaftler wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten in die Praxis abwandern.
Japan

Das letzte Referat des Tages kam von Harald Baum (Hamburg), der über akademische Karrierewege in Japan sprach. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft, das entweder mit dem Masterabschluss an der Fakultät oder dem Abschluss an einer Law School endet, besteht der erste Schritt in der Promotion,die in der Regel nach drei Jahren abgeschlossen wird. An die Promotion schließt sich eine Anstellung als Assistent und sodann als assoziierter Professor an, wobei der für die Karriere entscheidende Schritt derjenige vom Assistenten zum assoziierten Professor ist. Mit etwa fünfunddreißig Jahren erfolgt schließlich die Ernennung zum Ordinarius. Ein Verbot der Hausberufung gibt es in Japan nicht,und die Fakultäten sind insgesamt sehr frei darin, wie sie das Bewerbungsverfahren ausgestalten. Wie im Vereinigten Königreich muss auch die Rechtswissenschaft in Japan um Nachwuchs kämpfen, was daran liegt, dass die Verdienstmöglichkeiten in der freien Wirtschaft und in der Richterschaft deutlich besser sind als an der Universität. Hinzu kommt die hohe Arbeitsbelastung, denn die Fakultäten sind völlig selbstverwaltet, wobei die Professoren nicht einmal durch ein Sekretariat unterstützt werden.
Schlussdiskussion
In der Schlussdiskussion wurden zwei Aspekte vertieft: Zum einen basiert die Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Wesentlichen auf Kooptation. Am wenigsten ausgeprägt ist dies in Frankreich, wo neue Professoren in der agrégation gewählt werden, ohne dass die Fakultäten, an denen diese Professoren dann eingesetzt werden, mitentscheiden. Dieses System berücksichtigt die Bedürfnisse der Fakultäten nicht hinreichend, weswegen es in Italien 1998 abgeschafft wurde. Das gegenwärtige italienische System gibt den Fakultäten hingegen zu viel Einfluss, den diese dazu nutzen, Nachwuchs nur aus den eigenen Reihen zu rekrutieren. Ein angemessener Auswahlmodus muss solchen Klientelismus auf lokaler Ebene verhindern und zugleich die Autonomie der Fakultäten wahren.
Zum anderen stellte sich heraus, dass die Anforderungen, die an den akademischen Nachwuchs gestellt werden, nicht zuletzt davon abhängen, was von einem Hochschullehrer erwartet wird. Hierbei geht es vor allem darum, inwiefern die Universität auf die Praxis vorbereiten soll. Während Kurt Siehr (Hamburg) dafür eintrat, dass die Universität ihre Studenten in erster Linie auf die Praxis vorzubereiten habe, gab Reinhard Zimmermann zu bedenken, dass sich die Praxis am besten in der Praxis erlernen lasse. Die Universität solle eine Grundlagenausbildung bieten, auf die in der Praxis aufgesattelt werden könne.
Insgesamt förderten die fünf Vorträge und die sich anschließenden Diskussionsrunden Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen den akademischen Karrierewegen zu Tage. Welche Hürden es auf dem Weg zur Professur zu meistern gilt, hängt von der jeweiligen Wissenschaftskultur ab und wirkt zugleich auf diese zurück. Beim Jahrestreffen der „Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts“ wurden einige Wirkungszusammenhänge freigelegt und zahlreiche Anregungen dazugegeben, sich weiter mit akademischen Karrierewegen aus vergleichenderPerspektive zu befassen.
Jakob Gleim, Hamburg