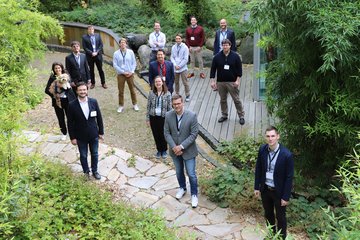Prof. Dr. Beate Rössler (Universität Amsterdam): Privatheit, gender und die Macht (in) der Öffentlichkeit
Gegenwartsdebatten
- Datum: 31.01.2025
- Uhrzeit: 16:00
- Ort: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Gegenwartsdebatten unter der Leitung von Professorin Dr. Anne Röthel war diesmal Professorin Dr. Beate Rössler zu Gast. Die Gegenwartsdebatten sehen sich der Tradition des Instituts verpflichtet, den Blick für Themen zu weiten, die nicht unmittelbar dem rechtswissenschaftlichen Bereich entstammen, aber dennoch mit diesem verbunden sind. Mit Frau Rössler war nun eine der renommiertesten Sozialphilosophinnen zu hören, die schwerpunktmäßig für ihre Arbeiten zu Konzepten von Autonomie und Privatheit bekannt ist. Die Wirkweisen, Konzeptionalisierungen und kritischen Potenziale von Privatheit standen im Mittelpunkt. Der Nachmittag unterteilte sich dabei in einen Workshop von 14:00 bis 15:30 Uhr sowie einen Vortrag von Frau Rössler mit anschließender Diskussion in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr.
Workshop

Neben Frau Röthel und Frau Rössler bereicherte Dr. Nora Becker, Post-Doc an der TU-Dortmund an der Fakultät für Philosophie und Politikwissenschaften, die Runde. Ihre Dissertation „Privatheit verstanden als Abgrenzung“ ist kürzlich im Nomos Verlag erschienen, sodass sie hinsichtlich der begrifflichen Fassung von Privatheit als Impulsgeberin fungierte. Frau Becker legt eine Ausdrucksanalyse vor, deren Ziel es ist, Verwendungsweisen und Cluster des Begriffes darzustellen. Sodann sollen begriffliche Strukturen und gemeinsame Nenner herausgeschält werden, die schließlich zu einer übersichtlichen Darstellung des gesamten Begriffs führen. Frau Rössler schaltet sich hier wohlwollend-kritisch ein und hinterfragt, inwiefern ein solche deskriptive Herangehensweise bei einem ‚dicken Begriff‘ wie der Privatheit möglich und sinnvoll ist. Ihr gehe es eher darum, die gesellschaftskritischen Potentiale des Begriffes zu nutzen, um von einer teilweise diskriminierenden Kategorie zu einem emanzipatorisch-liberalen Projekt zu gelangen. Für alle vornehmlich juristisch arbeitenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es eindrücklich zu erleben, wie sich innerhalb der philosophischen Disziplin unterschiedliche Herangehensweise in ganz verschiedenen Begriffsbildungen, sprachlichen Ausdrucksformen und Erkenntnisinteressen niederschlagen.
Diese Herausforderungen konnten auch für den interdisziplinären Blick zwischen Rechtswissenschaft und Philosophie beobachtet werden. Einerseits wurde attestiert, dass der Begriff rechtsdogmatisch keine allzu große Rolle spielt, aber dennoch in anderen Begriffen des positiven Rechts, als Ideal oder als Argument durchaus präsent ist. Dabei scheint eine Eigenschaft der Privatheit im Recht zu sein auf etwa anderes gerichtet zu sein oder funktional an einen anderen Begriff angeschlossen zu sein. So wurden etwa Privatheit und rechtlicher Personenstatus aber auch Würde und Privatheit in Beziehung gesetzt.
Vortrag und Diskussion

Im Ernst-Rabel-Saal folgte nun der Vortrag von Frau Rössler zum Thema: „Privatheit, Gender und die Macht in der Öffentlichkeit zu stehen“. Die Reihen füllten sich nicht nur mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Institut aus verschiedenen Arbeitsgruppen, sondern auch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Bucerius Law School, sowie weiteren Gästen etwa aus der Praxis.
Frau Rösslers Vortrag befasst sich mit der Verschiebung der Grenzen zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten bei Themen wie sexualisierter Gewalt oder Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen. Es sollen Entwicklungen nachgezeichnet werden, in denen Diskurse und Themen der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen aus dem Privaten in die Öffentlichkeit verschoben werden. Dabei geht es ihr darum aufzuzeigen, inwiefern diese Verschiebungen auch Machtverschiebungen darstellen hinsichtlich der Frage darstellen, was als Privat zu definieren ist, und insofern Teil eines emanzipatorischen Projekts sind. Sie stellt heraus, wie die Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten reguliert, welche Argumente zulässig sind und Gewicht haben. Insofern ist das Private seinem Wesen nach ambivalent. Es ist eben nicht nur schützender Rückzugsraum zur Entfaltung der eigenen Autonomie, sondern kann auch kritisches Nachfragen verhindern, Macht Strukturen konservieren und Diskriminierungen auf sublime Art und Weise verdecken.
Die Folge dessen ist für Rössler einerseits, dass die Grenze zwischen dem Öffentlichen und Privaten stets veränderlich und nicht natürlicher Weise verfasst ist. Insofern muss diese Grenze immer wieder in einem öffentlichen Gespräch verhandelt werden. Hier deutet Frau Rössler an, dass in diesem Gespräch die sozialen Medien besonders prägend geworden sind. Ihre Rolle sieht sie wiederum ambivalent: Sie erleichtern es einerseits Dinge in die Öffentlichkeit zu stellen, andererseits könne sie auch zu einer ungefilterten und wiederum herabwürdigenden Art der Auseinandersetzung führen. Schließlich verbindet Frau Rössler ihre Beobachtungen mit dem Appell, dass viele der erkämpften Freiheiträume entlang der Grenzziehung von Privatheit und Öffentlichkeit historisch erstritten wurden und teilweise wieder gefährdet sind.
Die zahlreichen Fragen spiegeln die große Resonanz wider, die der Vortrag im Auditorium gefunden hat. Es wird unter anderem gefragt, inwiefern auch eine Verschiebung in das Private eine emanzipatorische Wirkung haben kann oder inwiefern die Übertragung sozialphilosophischer Erkenntnisse in die familienrechtliche Praxis gelingen kann.
Zur Referentin
Beate Rössler ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität von Amsterdam; sie ist Mitherausgeberin des European Journal of Philosophy; Mitglied des Beirats des Instituts für Sozialforschung, Frankfurt. 2003/4 war sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, weitere Forschungsaufenhalte an der Macquarie University, Sydney (2011), an der University of Melbourne (2015), an der New York University (2017) und an der University of Pennsylvania (2023). Zu ihren Veröffentlichungen gehört Der Wert des Privaten, Frankfurt: Suhrkamp 2001; (englisch 2004); Von Person zu Person. Zur Moralität persönlicher Beziehungen, hg. mit Axel Honneth, Frankfurt: Suhrkamp, 2008; The Social Dimensions of Privacy. Interdisciplinary Perspectives, hg. mit Dorota Mokrosinska, Cambridge UP 2015; Autonomie. Ein Versuch über das gelungene Leben, Berlin: Suhrkamp 2017 (englisch 2021); zahlreiche weitere Veröffentlichungen zu sozial-philosophischen und ethischen Themen.
Bildnachweise: © Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht