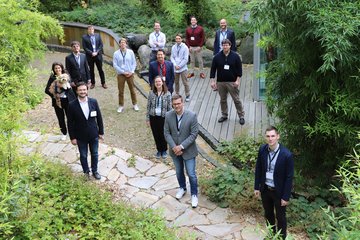Gleichheit im Sport
Sportrechtsymposium 2018
Das 11. Sportrechtssymposium des Forums für internationales Sportrecht – ein Gemeinschaftsprojekt des Max-Planck- Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg und des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München – fand am 19. November 2018 in Hamburg statt.
Das diesjährige Thema „Gleichheit im Sport“ erscheint auf den ersten Blick ein Widerspruch in sich zu sein. Gerade im Wettkampfsport versuchen die Athleten schließlich, nicht gleich, sondern besser als der jeweils andere zu sein. Jedoch lebt der sportliche Wettkampf natürlich von gleichen Bedingungen, um unterschiedliche Leistungen überhaupt erst vergleichbar zu machen. So wurden schon in der Antike verschiedene Altersklassen gebildet, um vorgegebene Ungleichheiten abzumildern. Auch heutzutage behilft sich der Sport mit der Bildung von Kategorien, um Gleichheit in der Ungleichheit zu ermöglichen – sei es durch getrennte Männer- und Frauenwettbewerbe, Altersgrenzen, die Ausrichtung von separaten Wettkämpfen für Menschen mit Behinderung oder die Klassifizierung von unterschiedlichen Behinderungen.

Kategorien im Sport müssen von Zeit zu Zeit überdacht werden
Professor Dr. Reinhard Zimmermann, Direktor des Max- Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, ging bei der Eröffnung des Symposiums auf die Motivation für die Themenwahl ein. So erscheine es lohnend, die bestehenden Kategorien im Wettkampfsport zu hinterfragen. Wann dienen diese der Chancengleichheit und wann verfestigen sie vielleicht Ungleichheit? Dabei bedürfe es insbesondere einer genaueren Betrachtung der verfassungsrechtlichen Dimensionen des Sportrechts. In diesem Zusammenhang sei ein maßgeblicher Impuls für die Auswahl des vielschichtigen Themas „Gleichheit“ die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 gewesen, in der das Fehlen einer positiven Eintragungsmöglichkeit für intersexuelle Menschen im Personenstandsrecht für verfassungswidrig erklärt wurde. Auch der internationale Sportbetrieb beschäftige sich bereits geraume Zeit mit der Frage, wie im Sinne der Chancengleichheit mit inter- und transsexuellen Athleten umgegangen werden sollte. Die Problematik stelle die Einteilung der Wettkämpfe in die Kategorien „Männer“ und „Frauen“ grundsätzlich in Frage und gebe Anlass, die Rechtfertigung von Kategorisierungen insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.

In dem Hauptvortrag des Symposiums beleuchtete Professor Dr. Michael Sachs, Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität zu Köln, das Thema „Gleichheit im Sport“ aus verfassungsrechtlicher Perspektive. Dabei bekundete er einleitend Zweifel an der Prämisse, dass Kategorienbildung die Chancengleichheit stets erhöhe. Gerade Personen, die in prinzipiell stärkere Kategorien eingeteilt seien, würden es unabhängig von ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit schwerer haben – so seien manche Männer nicht schneller als Frauen, würden jedoch nicht gegen diese antreten können. Mithin diene die Kategorisierung nicht der individuellen Fairness, sondern lediglich einer gruppenbezogenen relativen Chancengleichheit.
Verfassungsrechtliche Grundlage der Diskussion: Art. 3 Grundgesetz
Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG folge, dass Gleiches hinsichtlich der anzuwendenden Rechtsfolgen gleichbehandelt werden müsse. In diesem Zusammenhang stelle sich die essentielle Frage, was gleich sei. Davon sei auszugehen, wenn Personen ungeachtet anderweitiger Verschiedenheiten in der jeweils maßgeblichen Hinsicht übereinstimmende Eigenschaften hätten. Darüber hinaus seien die besonderen Diskriminierungsverbote in Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG von großer Bedeutung, wonach unter anderem niemand aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der Abstammung bevorzugt oder benachteiligt werden dürfe. Für Menschen mit Behinderungen gelte nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG Besonderes: Diese dürften bevorzugt, aber nicht benachteiligt werden. Demnach könne es grundsätzlich nicht beanstandet werden, eigene Wettbewerbe für Menschen mit Behinderungen zu veranstalten.
Verfassungswidrige Bundesjugendspiele?
Ausgehend von der Grundrechtsbindung der öffentlichen Gewalt (Art. 1 Abs. 3 GG) stellten sich vielfältige Gleichheitsfragen. Neben der staatlichen Sportförderung seien davon auch die je nach Sportart unterschiedlich intensive Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die sondergesetzlich begründeten Vermarktungs-Privilegien olympischer Verbände betroffen. Der Fokus des Vortrags solle jedoch auf personenbezogenen Diskriminierungen liegen. Exemplarisch dafür seien die Bundesjugendspiele, von deren Verfassungswidrigkeit Michael Sachs überzeugt ist. Da Jungen im Vergleich zu Mädchen für eine Ehrenurkunde bessere Leistungen erbringen müssten, liege eine staatliche Benachteiligung der Jungen und eine spiegelbildliche Bevorzugung der Mädchen vor. Eine „Unangemessenheit“ der Benachteiligung oder Bevorzugung – die man vorliegend in Abrede stellen könnte – sei nach dem Gesetzeswortlaut von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG gerade keine Voraussetzung für eine verbotene Diskriminierung. Das Bundesverfassungsgericht mache grundsätzlich nur zwei Ausnahmen hinsichtlich staatlicher Differenzierung nach dem Geschlecht. Zum einen sei eine unterschiedliche Behandlung zulässig, soweit sie zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur nach nur entweder bei Männern oder bei Frauen auftreten können, zwingend erforderlich ist. Diese Ausnahme beziehe sich auf strikt geschlechtsspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise die Fortpflanzungsorgane. Bezüglich der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit von Jungen und Mädchen handele es sich höchstens um geschlechtstypische Unterschiede, da es stets auch Mädchen gebe, die sportlich stärker als bestimmte Jungen seien. Zum anderen könnten eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Regelung oder kollidierendes Verfassungsrecht eine Differenzierung nach dem Geschlecht erlauben – eine solche Rechtfertigung bestehe im Sport jedoch aktuell nicht.
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Die verfassungsrechtliche Problematik lasse sich auch auf den Bereich des mittelbaren Staatshandelns und damit insbesondere auf die mit öffentlichen Mitteln finanzierte Spitzensportförderung übertragen. Diese Mittel verteilten die Sportverbände aufgrund der geschlechtsbezogenen Förderrichtlinien unter Verletzung des Gleichheitssatzes. Die Verfassungswidrigkeit betreffe daneben auch die Einstellung von Frauen bei der Polizei, der Bundeswehr oder dem Zoll, da diese im Vergleich zu Männern geringere Voraussetzungen erfüllen müssten. Im Bereich des Handelns von Privaten herrsche mangels unmittelbarer Grundrechtsbindung dagegen ein anderer Beurteilungsmaßstab. Der Staat sei den verfassungsrechtlichen Anforderungen an seine Schutzpflicht insbesondere durch Schaffung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gerecht geworden. Im Rahmen des AGG und der Ausstrahlungswirkung des Gleichheitssatzes auf das Privatrecht sei zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der sachliche Grund, dass Frauen typischerweise im Sport weniger leistungsfähig seien als Männer, ausreichend.
Mithin hält Michael Sachs hinsichtlich des unmittelbaren und mittelbaren Staatshandelns im Sport eine Änderung des Grundgesetzes für erforderlich, um die Verfassungswidrigkeit der gegenwärtigen Zustände zu beseitigen. Namentlich könne eine Bereichsausnahme in Art. 3 Abs. 3 GG zugunsten einer unterschiedlichen Behandlung von Frauen und Männern im Sport eingeführt werden.

Im Anschluss berichtete Christoph Becker von seinen Eindrücken als Sportredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Thema „Gleichheit im Sport“ werfe auch journalistisch interessante Fragen auf. Als Beispiel nannte er die große mediale Aufmerksamkeit gegenüber der intersexuellen südafrikanischen 800-Meter- Läuferin Caster Semenya. Seit ihrem Sieg bei der Leichtathletik- Weltmeisterschaft im Jahr 2009 befinde sich diese aufgrund ihrer Erfolge und ihres Hyperandrogenismus im Auge der breiten Öffentlichkeit. Noch heute kämpfe der internationale Sport um den korrekten Umgang mit intersexuellen Athletinnen. Die International Association of Athletics Federations (IAAF) habe zuletzt bei Hyperandrogenismus die Starterlaubnis für die Laufstrecken zwischen 400m und einer Meile nur erteilt, wenn zuvor der Testosteronspiegel durch Einnahme von Hormonen gesenkt worden sei. Diese Regelung sei jedoch im Zuge der Klage einer intersexuellen Sportlerin aus Indien vor dem Court of Arbitration for Sport (CAS) suspendiert worden – das Urteil werde für März 2019 erwartet. Erwähnenswert sei in diesem Zusammenhang, dass nach den Regeln des Radsportweltverbandes Union Cycliste Internationale (UCI) im Jahr 2018 Rachel McKinnon als erste Transgender-Athletin Weltmeisterin in der Masters-Klasse (35 bis 44 Jahre) geworden sei. Kritisch betrachtete der Journalist, dass bei der Diskussion um inter- und transsexuelle Athleten aus dem Blick gerate, dass Doping für die – fehlende – Vergleichbarkeit von Leistungen das größere Problem sei. So habe Caster Semenya auch bereits gegen eine nachweislich gedopte Athletin aus Russland verloren.
Erörterungsbedürftig sei die Geschlechtertrennung insbesondere auch im Motorsport, wo eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit nicht auf der Hand liege. Ab dem Jahr 2019 solle eine sogenannte „W Series“ für bis zu zwanzig weibliche Rennfahrerinnen und mit 1,5 Millionen Dollar Preisgeld veranstaltet werden. Die britische Rennfahrerin Pippa Mann habe diese separate Rennserie jedoch mit der Begründung kritisiert, dass das Geld besser direkt in die Frauenförderung investiert werden sollte, um diese hinsichtlich der männlichen Fahrer konkurrenzfähig zu machen.

Professorin Dr. Anne Jakob, die als Rechtsanwältin auf Sportrecht spezialisiert ist und in nationalen sowie internationalen Sportverbänden gearbeitet hat, kritisierte ebenfalls den Umgang der IAAF mit intersexuellen Sportlerinnen. Die von dem Verband festgelegten Testosterongrenzwerte seien nicht praktikabel. Zwar seien nach einer Studie bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2011 wohl rund vierzehn Prozent der Spitzensportlerinnen von Hyperandrogenismus betroffen, so dass die Thematik abseits bekannter Einzelfälle eine gewisse Relevanz habe. Jedoch hätten andere wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass sich der höhere Testosteronspiegel nicht in allen leichtathletischen Disziplinen auswirke. Lediglich über 400 Meter, 400 Meter Hürden, 800 Meter, im Stabhochsprung und im Hammerwurf konnte ein Vorteil von bis zu 4,5 Prozent festgestellt werden. Die Ergebnisse der Studie rechtfertigen aus Sicht von Anne Jakob einen – medizinisch nicht indizierten – Eingriff in den Hormonhaushalt der betroffenen Athletinnen nicht. Zudem gebe es die verschiedensten körperlichen Unterschiede bei Athleten wie Größe oder Blutproduktion, die sich ebenfalls auf die Leistungsfähigkeit auswirkten und nicht behandelt werden müssten. Demnach sei intersexuellen Athletinnen gerade auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten die Startberechtigung uneingeschränkt zu gewähren.

Als Paralympics-Siegerin im Rollstuhlbasketball und Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft berichtete Mareike Miller von ihren Erfahrungen im Leistungssport. So liefere ihre Sportart ein besonderes Beispiel für Gleichheit im Sport. Dort werde „Inklusion rückwärts“ gelebt. Sie selbst spiele aufgrund mehrerer Kreuzbandrisse sowie Arthrose in den Knien Rollstuhlbasketball. Für eine Startberechtigung sei grundsätzlich erforderlich, dass die unteren Extremitäten permanent und nachweislich medizinisch eingeschränkt seien. Dabei reiche auch – wie bei ihr – eine sogenannte „Minimalbehinderung“ als Behinderungsgrad für die Einstufung in den Rollstuhlbasketball aus. Mithin übten nicht nur Rollstuhlfahrer den Sport aus, sondern auch Fußgänger. Um zwischen den verschiedenen Teams Vergleichbarkeit herzustellen, werde jeder Sportler je nach Stärke seiner Behinderung auf einer Skala von 1,0 bis 4,5 Punkten eingestuft – insgesamt dürfe ein Team 14 Punkte erreichen. Während für Männer und Frauen getrennte internationale Wettbewerbe bestünden, seien die Teams in deutschen Ligabetrieben gemischt. Für Frauen gebe es dort zum Ausgleich von physiologisch nachgewiesenen Leistungsunterschieden einen Klassifizierungsbonus von 1,5 Punkten. Mithin könne der Rollstuhlbasketball als inklusivste Sportart der Welt bezeichnet werden. Er sei damit ein Vorbild, wie es gelingen könne, Menschen mit sehr unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen auch im Sport auf einem gemeinsamen Feld zusammenzuführen.

Dr. Petra Tzschoppe, Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung im Deutschen Olympischen Sportbund und Sportsoziologin an der Universität Leipzig, erörterte die Chancengleichheit im Sport aus verbandsrechtlicher und soziologischer Perspektive. Ein wesentlicher Aspekt von Gleichheit im Sport sei als Ausgangspunkt zunächst die Partizipation am Sport. Dabei verwies sie auf eingeschränkte Zugangschancen in Abhängigkeit von Herkunft, Geschlecht oder Behinderung. So seien Frauen lange Zeit vom Wettkampfsport ausgeschlossen gewesen. Noch 1912 habe sich etwa Pierre de Coubertin darüber beschwert, dass die „feministischen Schweden“ die olympischen Schwimmwettbewerbe für Frauen geöffnet hatten. Bis heute gebe es Ruderclubs, die keine Frauen aufnehmen. Die Zugangschancen von Menschen mit Behinderungen müssten ebenfalls stärker gefördert werden, da diese im Sport weiterhin prozentual unterrepräsentiert seien. Zudem gebe es auch viele Barrieren für Kinder aus sozial schwachen Familien oder mit Migrationshintergrund. Diesbezüglich gelte es, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um das Potential des Sports – seine große sozialintegrative Kraft – weiter zu entfalten.
Im Anschluss entwickelte sich unter Moderation von Professor Dr. Ulrich Becker, Direktor des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, eine lebhafte Diskussion. So kam die Nachfrage auf, ob die von Michael Sachs vorgestellte Gleichheitsdogmatik als allgemeines Fairness-Prinzip auch mittelbare Drittwirkung bei privaten Sportveranstaltungen entfalten könne. Eine so weitgehende Grundrechtswirkung hielt Michael Sachs jedoch für bedenklich und nicht erforderlich. Erörtert wurde darüber hinaus, ob sich aus den Unterschieden bei männlichen und weiblichen Höchstleistungen nicht doch ein geschlechtsspezifisches Differenzierungskriterium ergeben könne. So wurde argumentiert, dass die absoluten Leistungsunterschiede auf grundsätzlich unterschiedliche biologische Voraussetzungen zurückzuführen sein müssten. Damit wäre dann entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Differenzierung zwischen den Geschlechtern ohne Gleichheitssatzverstoß auch im Sport möglich. Michael Sachs stimmte zwar zu, dass eine Kategorisierung in „männlich“ und „weiblich“ letztendlich aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit die praktikabelste Lösung für den Sport sei. Dennoch sei die Fähigkeit zu Höchstleistungen grundsätzlich nur ein geschlechtstypisches Merkmal – solche Typisierungen lasse die verfassungsrechtliche Dogmatik allerdings nicht zu.
Des Weiteren diskutierten die Teilnehmer, ob das inklusive Model des Rollstuhlbasketballs ein Vorbild für andere Sportarten sein könnte. Insbesondere die stärkere Vernetzung von Nichtbehinderten- und Behindertensportlern wurde als Förderungsziel betrachtet. Mareike Miller erläuterte, dass bei Mannschaftssportarten grundsätzlich erforderlich sei, dass alle Athleten das gleiche Sportgerät einsetzen. So wäre es auch im Rollstuhlbasketball zu gefährlich, wenn einige Teilnehmer keinen Rollstuhl benutzen würden, da dieser auch Schutz vor Kontaktverletzungen gewähre. Anne Jakob bemerkte, dass ein Punktesystem auch bei Individualsportarten unterschiedliche Beeinträchtigungen ausgleichen könne.
Christoph Becker und Petra Tzschoppe wiesen darauf hin, dass das International Olympic Committee (IOC) die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern durch gemischte Wettbewerbe stärker fördern werde. Eine Lösung für den Umgang mit den im Symposium erörterten Gleichheitsfragen sei auch dies jedoch nur bedingt, da die teilweise problematische Kategorisierung von Männern und Frauen bestehen bleibe.

Zum Abschluss des Symposiums resümierte Ulrich Becker, dass unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Symposiums Konsens darüber bestehe, dass Kategorien der Gleichheit im Sport grundsätzlich dienlich seien. Gleichzeitig müsse sich der Sportbetrieb jedoch stärker darum bemühen, Menschen mit vielfältigen körperlichen Voraussetzungen zu integrieren. Es habe sich dabei am Beispiel des Rollstuhlbasketballs gezeigt, dass es vielfältige Möglichkeiten gebe, Vergleichbarkeit im Sport herzustellen.